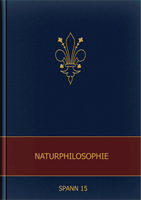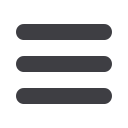120
[132/133]
1.
Möglichkeit der Unterstellung einer „Wechselwirkung“
der Teile (statt der Unberührbarkeit der Glieder, die ganzheitlich
gefordert ist);
2.
Möglichkeit der Unterstellung zahlenmäßiger Bestimmbar-
keit und mechanischer Ursächlichkeit (statt der Zergliederung
des s i n n v o l l e n Gliederbaues der Leistungen in echten
Ganzheiten).
Wir untersuchen nun der Reihe nach die einzelnen Fragen.
I.
Annähernde Selbstlosigkeit und annähernde Gleichartigkeit
der Teile in den Naturdingen
Die geistig-gesellschaftlichen und die organischen Ganzheiten
sind dadurch gekennzeichnet, daß ihre Glieder Eigenleben (vita
propria) haben. In gesellschaftlichen Ganzheiten sind es be-
sonders die einzelnen Menschen, in den biologischen Ganzheiten
die Organe und Zellen, denen verhältnismäßige Eigenlebendig-
keit und individuelle Besonderheit, in der sie einander ergänzen,
zukommen. Die anorganische Natur dagegen scheint in ihren
Setzungen dadurch gekennzeichnet, daß die Teile, z. B. eines
Stückes Eisen, eines Steines, so gut wie gleichartig seien. Augen-
fällig kommt diesen Teilen nicht jene Selbständigkeit zu, die der
Eigenlebendigkeit der organischen und geistigen Ganzheiten
gliche. Die herrschende Meinung, vor allem die mathematische
Physik, spricht den Teilen (wie allerdings auch den Dingen
selbst) jegliche Selbstbestimmung und jegliche Eigenlebendigkeit
(vita propria) ab, demgemäß auch dem Wesen nach jede
individuelle Besonderheit, Ungleichheit. — Das Gleichartige,
Unindividuelle der Teile ist nur die andere Seite ihrer Unselb-
ständigkeit, ihres Mangels an Selbstbestimmung, Freiheit, Vita /
propria. Daher nimmt die mechanistische Physik ein unbedingt
eindeutiges, mathematisch bestimmbares Verhalten an.
Geht man dagegen von dem immateriellen Grunde der Natur
aus und erkennt man die Naturerscheinungen als dessen Set-
zungen
1
, so kann eine unbedingte Eindeutigkeit und mathemati-
sche Bestimmtheit niemals zugegeben werden. Nun können die
Dinge nicht durchaus ohne Selbstbestimmung, demgemäß auch
1
Vgl. oben S. 73f., 118 und öfter.