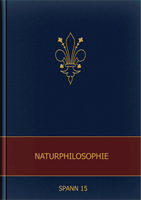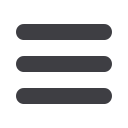[56/57]
55
In ihrer Eigenschaft als Einheit also, von der aus die Teile
erst verständlich sind, erst das werden, was sie sind, erweist sich
die Gestalt als überräumlich. Das, was an einem Kristall, einer
Landschaft Gestalt ist, sind, wir wiederholen es, nicht die ein-
zelnen Linien für sich; erst eine höhere, ausgliedernde, das
Einzelne befassende Einheit (Ganzheit) macht sie zu Gestalt-
teilen, Strukturelementen. Dieses in den Linien Sichdarstellende
kann also nicht selbst Linie sein. Einheit ist kein bloßes Neben-
einander (darum auch nicht summativ), sondern b e f a ß t dieses,
ist darum auch anderes, „mehr“ als das Nebeneinander des
Raumes — ist überräumlich.
Die Gestalt beweist ihrerseits wieder den Satz: Raum ist nur
durch Überräumliches möglich.
Unser Ergebnis ist: Sowohl die Stetigkeit als ein Miteinander-
bestehen der Raumteile; wie die Gestalt als ein Inein- / ander-
bestehen der Raumteile führen auf ein Uberräumliches im
Raume. Von beiden aus begründet sich der Satz: Raum ist nur
durch Überräumliches möglich.
Wieder stoßen wir auf das Primurn movens, die Natura na-
turans, von der aus allein die verdinglichte Natur, wie wir sie
mit Augen sehen, zu begreifen ist, auf das Vorräumliche, Über-
räumliche, dasjenige, was sich verräumlicht.
Das Überräumliche des Raumes äußert sich auch in der D u r c h d r i n g -
l i c h k e i t des Stoffes. Jeder Raum ist ein Ineinander vieler Verräumlichungen.
Doch wird das erst später zu erörtern sein
1
. Die weitere Entwicklung und die
V o l l e n d u n g d e s G e s t a l t b e g r i f f e s ist erst möglich, wenn der Weg
der Verräumlichung selbst betrachtet wird
2
.
Zusatz: Dialektisches oder ganzheitliches Gefüge
des Raumes?
Die bisherige Zergliederung der Merkmale des Raumes gibt
uns nun die Begriffsmittel an die Hand, um zu einer Frage
Stellung zu nehmen, die in der Naturphilosophie der Romantik
und des deutschen Idealismus eine große Rolle spielte, zur
Frage des dialektischen Gefüges, der „Polarität“ des Raumes.
K a n t ging in seiner Naturerklärung von zwei einander ent-
gegengesetzten Kräften, der „Repulsion und Attraktion“ aus.
Die Naturphilosophie der R o m a n t i k und des deutschen
1 Vgl. unten S. 83ff.
2
Vgl. unten S. 65ff., 74ff. und 94ff.
5*