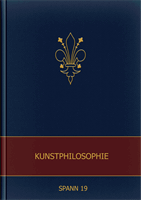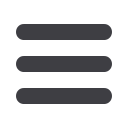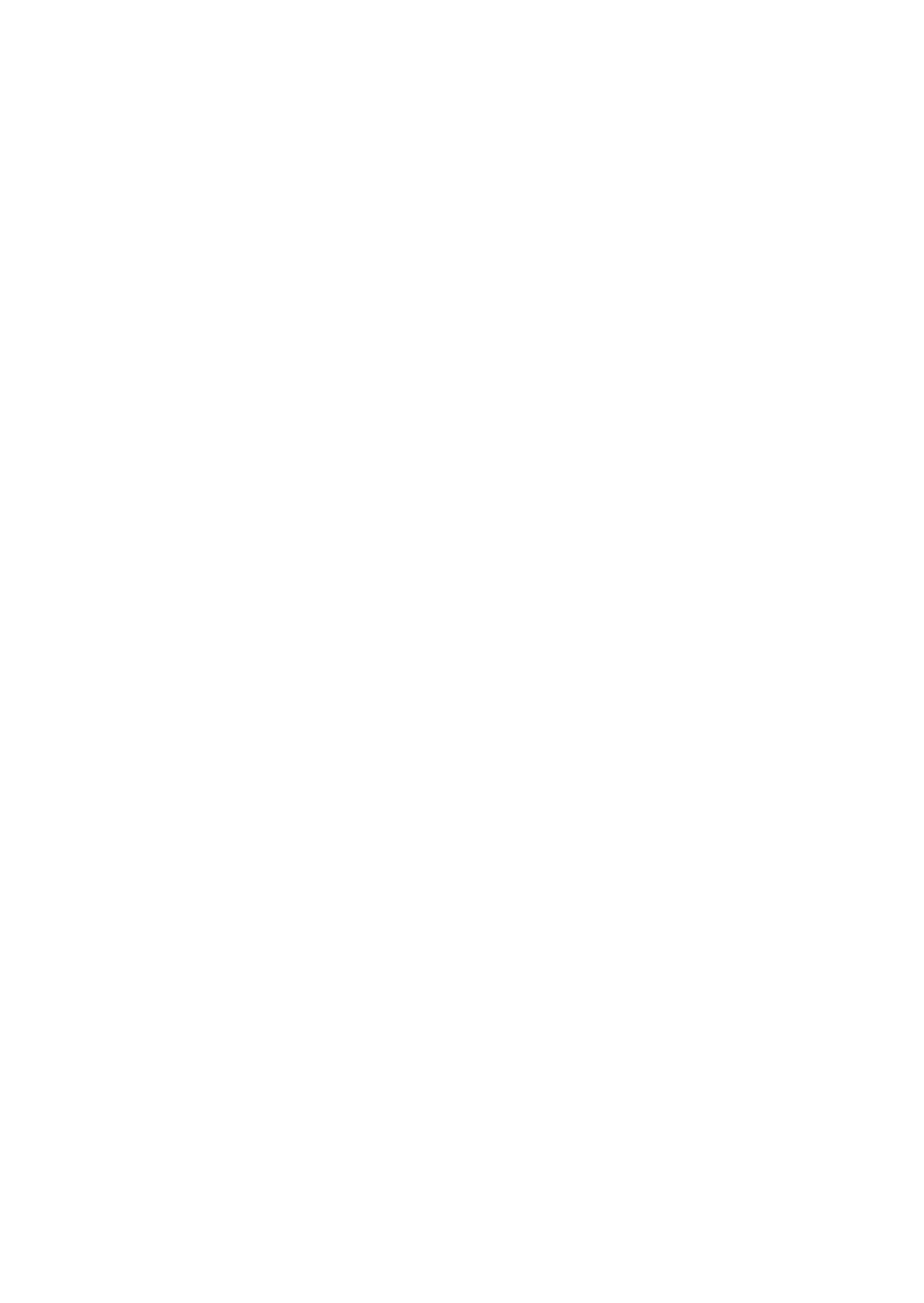
224
Für unsere Auffassung des Wesens von Klassik und Romantik spricht S c h i l -
l e r s reife Schrift „Uber naive und sentimentalische Dichtung“ (1795/96). Naiv
ist ihm der mit der Natur einige Dichter, wofür ihm die alten Griechen das
Beispiel sind; sentimentalisch jener Dichter, der diese Einheit verlor, wofür ihm
die Neuzeit das Beispiel ist.
Wenn wir uns allerdings nicht auf die Einheit mit der Natur oder den Zwie-
spalt mit ihr beschränken, vielmehr auf das Metaphysisch-Religiöse als der letzten
Grundlage der Dichtung alles zurückführen, so finden wir doch eine innige Ver-
wandtschaft mit unseren Unterscheidungen. (Die Einheit mit der Natur ist stets
abgeleitet; Homer hatte sie, weil er mit den Göttern, auch den Naturgöttern,
verkehrte; Goethe aus einem verwandten Gefühle der Einheit mit göttlichen
Wesenheiten heraus.)
Indem die Romantiker sich selbst später nicht „sentimentalisch“, sondern „ro-
mantisch“ nannten, trat an die Stelle des Gegensatzes „naiv-sentimentalisch“
jener von „klassisch-romantisch“. Schiller selbst nannte später die „Jungfrau von
Orleans“ romantisch, nicht sentimentalisch.
F r i e d r i c h S c h l e g e l bestimmte die Romantik verschieden. Im „Athe-
näum“ sagte er: „Die romantische Poesie ist eine progressive Universalpoesie“
(Was wir aus der ins Unendliche gerichteten Sehnsucht des Romantikers zu ver-
stehen haben). „Ihre Bestimmung ist nicht bloß, alle getrennten Gattungen der
Poesie wieder zu vereinigen“ (man denke an die Lyrik im Romane, z. B. im
,Meister
1
und in ,Ahnung und Gegenwart“, sowie an Tiecks Märchendramen) „und
die Poesie mit der Philosophie“ (damals der Wissenschaftslehre Fichtes) „und
Rhetorik in Berührung zu setzen. Sie will auch Poesie und Prosa, Genialität und
Kritik, Kunstpoesie und Naturpoesie“ (man denke an das Volkslied) „bald ver-
mischen, bald verschmelzen“
1
. - Die ebenfalls von Friedrich Schlegel zuerst
(später namentlich von K a r l W i l h e l m F e r d i n a n d S o l g e r ) hervor-
gehobene „ r o m a n t i s c h e I r o n i e “ ist nichts anderes als die Scham über
die oft zu weiten Vorstöße ins unbekannte Land der Unendlichkeit, der Über-
welt; oder auch die Zurückziehung solcher Vorstöße auf bloße Sinnbildlichkeit.
Wie ersichtlich, sind diese Versuche Schillers wie der Romantiker selbst in
unserer Begriffsbestimmung mit eingeschlossen. Das wird sich auch später bei Be-
trachtung der Gestaltung und Rückverbindung zeigen.
Die Romantik aller Zeiten hat etwas Heiliges, Edles und Hin-
reißendes an sich. Denn ihr Ichhaft-Schwankendes ist keine uferlose
Willkür; es haftet vielmehr an dem ernsten inneren Ringen und
Streben, das sich manchmal zu weit ins Unerfaßbare vorwagt (man
denke nur an Beethoven). — Ein solches Ringen ist eine allgemeine
menschliche Notwendigkeit. Geht es nur immer vom festen Grunde
der Dinge aus, so hat es auch einen festen Halt an der gegenständ-
lichen Notwendigkeit des Wirklichen.
1
Athenaeum, Eine Zeitschrift von Wilhelm Schlegel und Friedrich Schlegel.
Neu herausgegeben von Fritz Baader = Das Museum, Bd IV, Berlin 1905, S. 51.