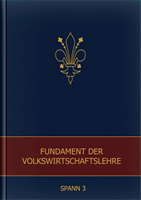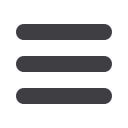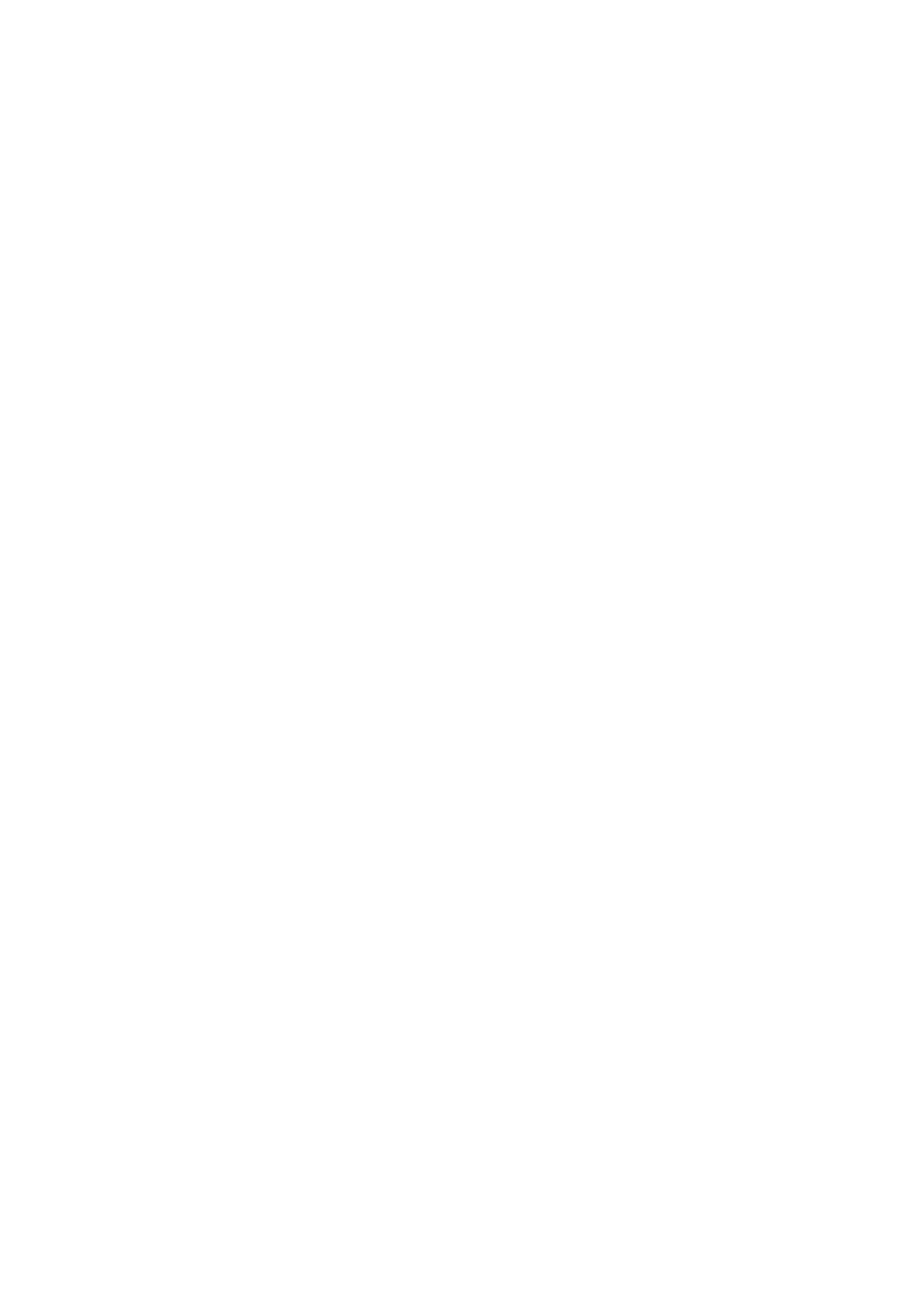
[85/86]
107
nur Glieder. Ob a b e r e i n W a s s e r z u w a c h s u n d w i e v i e l d a v o n
G l i e d i m j e w e i l s V o r g e f u n d e n e n G l i e d e r b a u d e r
M i t t e l w e r d e n k a n n , l i e g t a n d e r B e s c h a f f e n h e i t
d i e s e s G l i e d e r b a u e s !
Die
Grenznutzenlehre
macht
außerdem
den
Fehler,
die
B e d ü r f n i s b e f r i e d i g u n g
g r u n d s ä t z l i c h
n a c h
m a t e r i a l i s t i s c h e r A r t z u b e t r a c h t e n , gewissermaßen nur vom
Standpunkte des Essens und Trinkens aus — als ob es nur verbrauchliche Güter gäbe!
Es g i b t a u c h unverbrauchliche Güter. Ein Bild können 2 oder 100 000 Menschen
ansehen; Kenntnisse, Erfindungen verbrauchen sich nicht! Und so fort
1
. Wesentlich ist
ferner, daß das lebensnotwendigere Bedürfnis (Essen und Trinken) nicht immer das
ranghöhere, das wichtigere und wertvollere ist. Hierfür noch ein letztes Beispiel. Wenn
ein hochgesinnter junger Mann, der bisher vom Studium wegen vollständiger Armut
ausgeschlossen war, durch eine Erbschaft in die Lage versetzt wird, zu studieren und
sich einem geistigeren Leben zu widmen, so steigt er durch Verwendung dieses
Zuwachses nicht zur Befriedigung minder wichtiger Bedürfnisse herab! Ihm wird jetzt
erst das Leben lebenswert, er konnte vielleicht vor Verzweiflung und
Selbstmordgedanken dadurch gerettet werden — die Zuwüchse bedeuten ihm die
„ K r o n e d e s L e b e n s “ , sie haben für ihn keinen abnehmenden, sondern
einen zunehmenden Wert.
/
Daß allerdings immer wieder ein Punkt kommt, an welchem die Zielerreichung zu
Ende und eine „Grenze“ ist, ist wohl richtig. Das e r g i b t a b e r k e i n e
s t e t i g a b n e h m e n d e O r d n u n g d e r N u t z u n g e n u n d
d a h e r a u c h k e i n e n G r e n z n u t z e n a l s R e c h e n g r ö ß e !
Die Grenznutzenlehre hat jenen einen Fall fälschlich verallgemeinert, wo (wie beim
„abnehmenden Bodenerträge“) einseitige Mehraufwände n a c h E r r e i c h u n g
e i n e s O p t i m u m s darum einen abnehmenden Ertrag bringen, weil die anderen
Erzeugungsmittel (z. B. Bodenfläche) festgelegt sind. Dabei übersieht sie aber, daß bis
zur Erreichung des Optimums die Erträge zunehmen können und ferner stets neue
Optima entstehen
2
.
Will man die Frage der Bildung der Leistungsgrößen und des
Rechnens mit ihnen lösen, so darf man nicht die Psychologie des Ab-
schätzens dieser Leistungsgrößen, man darf noch weniger die
Psychologie der Genußgefühle zur Grundlage machen, wie es Menger
und seine Schüler taten. Denn obgleich die Wichtigkeit der Ziele
allerdings nur durch das Abschätzen des Subjektes zur Geltung kommt
(Wichtigkeit und Genuß sind überdies ganz und gar nicht das
gleiche!), so kommt sie doch durch das Subjekt hindurch zur Geltung,
nämlich als ein Objektives, das die Prämisse des Subjektes bildet. Es
handelt sich also um den objektiven Gliederbau zuerst
1
Siehe unten S. 170 und 215.
2
Vgl. dazu meinBuch: Die Haupttheorien der Volkswirtschaftslehre,
26. Aufl., Heidelberg 1949, S. 71 ff., und unten S. 257 und 318 f.