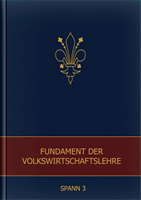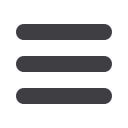28
[14/15]
der „Unterschied zwischen Kosten und Nutzen“.
1
Eine solche
Verworrenheit schreit zum Himmel! Denn wären Kosten etwas
Objektives für sich (z. B. Arbeitsmengen), so sind sie mit dem Nutzen
nicht vergleichbar; sind aber Kosten auf Nutzen zurückzuführen (z. B.
als „entgangener Nutzen“, wie unten noch auszuführen sein wird
2
), so
ist es klar, daß es nicht die S p a n n u n g zwischen entgangenem und
erreichtem Nutzen ist — der „Ertrag“ —, auf dem die Wirtschaft
beruht, sondern nur wieder der N u t z e n des her-
ausgewirtschafteten „Ertrages“! Die Ersparnis (der Ertrag) ist eben
keine ursprüngliche, primäre Größe, sondern leitet sich vom Nutzen
her. Betrachtet man sie primär, so macht man den lustigsten
Purzelbaum, der im theoretischen Denken je geschlagen wurde, da sie
doch erst aus wirklichemWirtschaften folgen kann, welches entweder
auf dem Nutzen oder irgend etwas anderem beruhen muß. — Noch
unerträglicher wird die begriffliche Unklarheit, wenn Lief- mann
Nutzen und Kosten als etwas „Psychisches“ faßt und das Wesen der
Wirtschaft im Vergleiche dieser beiden „psychischen“ Größen findet.
Wäre es mit / dem „psychischen“ Charakter der Wirtschaft ernst, so
müßte die Volkswirtschaftslehre wieder Psychologie werden.
Diese kurze Übersicht zeigt, welche Schwierigkeiten und
Widersprüche es sind, mit denen der Begriff der Wirtschaft zu
kämpfen hat, welch verschiedene Elemente in ihm liegen und von den
verschiedenen Theorien jeweils in den Vordergrund gerückt werden.
Es ist zuerst die Vermischung des Wirtschaftlichen mit dem
Stofflichen (Technischen), dann mit dem Seelischen, dann die
Vermischung der Wirtschaft als solcher mit dem geschichtlich-
empirischen Ganzen der Gesellschaft, endlich die Scheidung oder
Verbindung der Individualwirtschaft mit der Verkehrswirtschaft, was
wir als die Hauptschwierigkeiten des Wirtschaftsbegriffes erfanden.
Wenn nun im Nachfolgenden versucht wird, einen Begriff der Wirtschaft zu bilden,
der jene Gefahren und Mängel überwindet und imstande ist, die Ent-
1
Robert Liefmann: Grundlagen der Wirtschaft (Grundsätze der Volkswirtschaftslehre,
Bd 1), 2. Aufl., Stuttgart 1920. — Zur Auseinandersetzung mit Liefmann vgl. auch Alfred
Amonns Besprechung des Liefmannschen Buches: Geld und Gold, ökonomische Theorie des
Geldes, Stuttgart 1916, im Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, Jg 1918.
2
Siehe unten § 6, III und V, und § 9, S. 102 f., 104 ff. und 118 f.