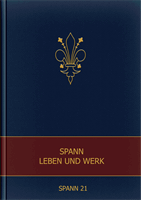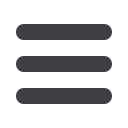

279
anzurühren; es bleibt im rein Weltlichen befangen — dies muß aber
keineswegs für alle „naturalistische“ Kunst gelten.
Das Lustspiel ist nach Spann ein Werk, das nicht in die Tiefe geht,
was seine Ursache im Lächerlichen hat. Das Satyrspiel der Griechen
jedoch, das sich als viertes Stück an drei Tragödien anschließt, ist
religiös fundiert, wie ja auch die griechischen Götter auf das kräftigste
lachen konnten. In diesen Zusammenhang ist auch die „romantische
Ironie“ zu stellen, die auf dem unauslöschlichen Widerstreit des
Bedingten und des Unbedingten gründet, wie dies die Brüder Schlegel
formuliert haben.
Mehr noch als eine Unvollkommenheitsform des Schönen ist das
Unholdisch-Häßliche, der Satanismus. Dieser kann im schlimmsten
Fall eine Gegenmacht darstellen, die sich auf die Verneinung des
Guten stützt. Die Finsternis tritt als Gefährdung der Existenz der
Kunst überhaupt auf. Es handelt sich hiebei keineswegs um Schwäche
des Rückverbundenheitsbewußtseins, sondern um Anhängerschaft
des Künstlers an das Unholdische, in letzter Konsequenz um Teufels-
anbetung. Diese Entwicklung ist im negativen Sinn viel mehr als das
Unholdisch-Schöne, welches ja notwendigerweise zum Kunstschaffen
gehört. In diesem positiven Sinn sagt Rainer Maria Rilke in der
ersten der Duineser Elegien: „Das Schöne ist nichts als des Schreck-
lichen Anfang“
8
.
Es wird immer problematisch bleiben, in der Kunstphilosophie ein
strenges Kategoriengebäude aufstellen und konsequent anwenden zu
wollen. Anders als in der Erkenntnistheorie, der Logik, der Gesell-
schaftslehre und -philosophie, der Geschichtsphilosophie u. a. ist
das vorliegende Thema seinem Wesen nach unendlich schwerer in
einen kategorialen Aufbau zu fassen. Dies liegt im Wesen der Sache
begründet. Beim Studium von Spanns Kunstphilosophie erschließt
sich dem Leser wie in den anderen Werken eine Anwendung der
ganzheitlichen Kategorien, es bleibt aber bewußt, daß alle Kunst sich
einer durchgängigen Kategorisierung zu entziehen scheint. Umso
höher ist aber die denkerische Leistung zu werten, die dieses Wagnis
unternimmt.
8
Rainer Maria Rilke: Duineser Elegien, Frankfurt am Main 1970, S. 9.