
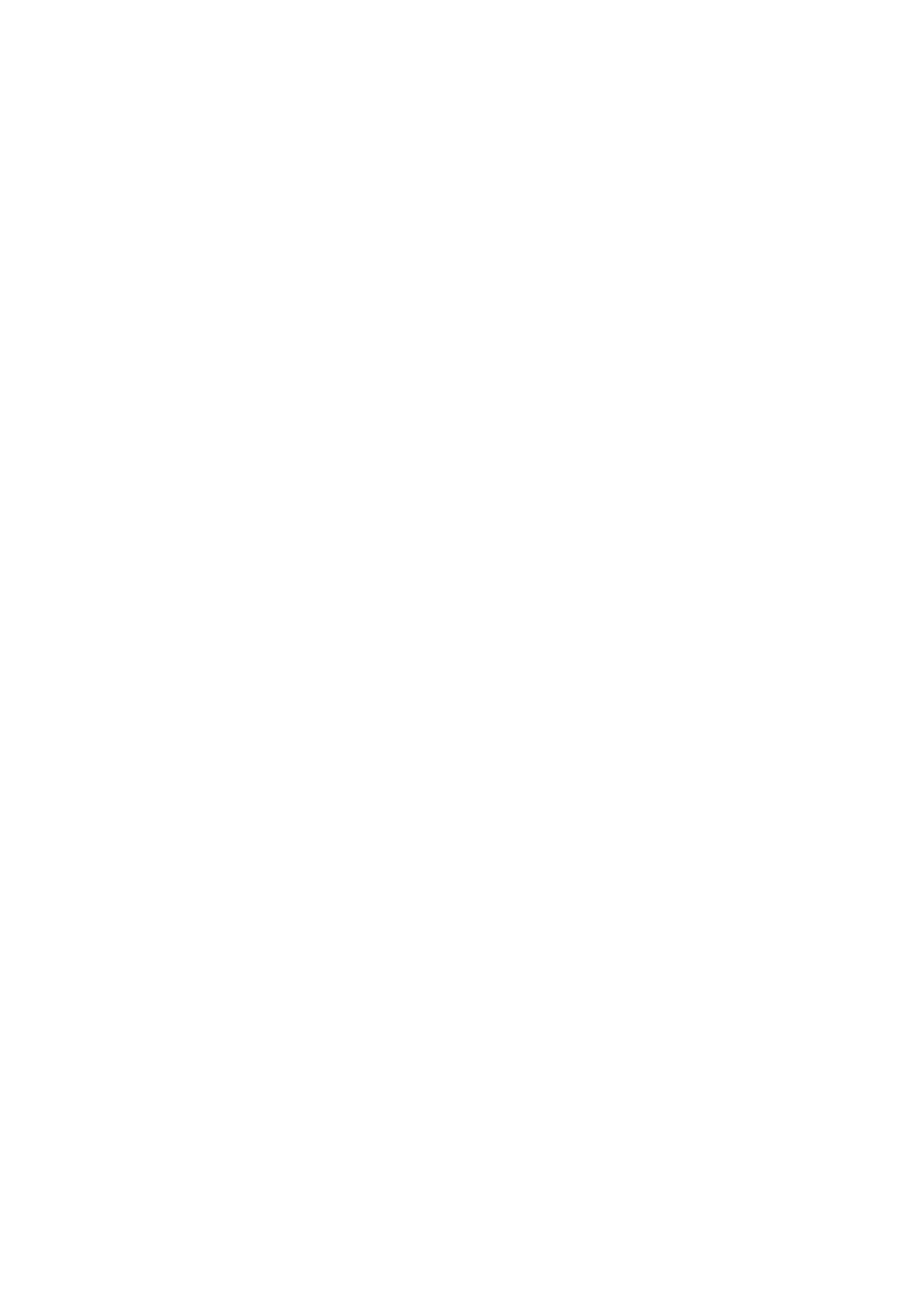
372
[307/308]
chanischen Sinne wie z. B. T a i n e , B u c k l e und ihre Nachfolger
glauben machen wollen.
Lassen wir zuerst wieder Beispiele sprechen. Die Stoffe Homers, des Äschy-
los, des Sophokles, Euripides, selbst Calderons, Shakespeares sind uns heute oft
bis zur Unverständlichkeit fremd. Aber auch fremdartiges Äußeres läßt voll-
gültiges Inneres durchschimmern und darum bleiben uns solche Kunstwerke den-
noch Träger ewiger Schönheit. Es zeigt sich, daß der Stoff bloß etwas zu Ge-
staltendes überhaupt ist, das in seiner Besonderheit als gleichgültiges Gefäß oder
Symbol für den Kunstinhalt dient. Diese Auffassung schließt durchaus keine for-
malistische Ästhetik in sich, denn ob Schönheit einen Inhalt habe und welchen,
darüber ist damit noch gar nichts entschieden. Im „Ödipus“ des Sophokles wird
die Tragödie des Lebens an Vorgängen, die der Wirklichkeit des heutigen Lebens
fernliegen, dargestellt, aber die metaphysische Rührung unseres Gemüts ist so
groß, wie sie durch keinen Neuern übertroffen werden könnte.
/
Der Stoffzwang, dem die Kunst jeder Zeit unterliegt, bedeutet
also nicht das, was die „Milieutheorie“ behauptet, nämlich nicht,
daß die Kunst ein „Reflex“ der jeweiligen Umstände sei!
Um in diesem Punkte dem mechanischen Umweltbegriff richtig
zu begegnen, muß man sich außerdem noch klarmachen, daß die
Kunst aus jeder Stoffart ein Gleiches herausholen kann. Die Schick-
salsidee kann am „Ödipus“ oder an der „Accorombona“ (Renais-
sancezeit, Tieck) dargestellt werden. Der Kunst kann alles Stoff
werden, Natur und Seele, Himmel und Erde, wie es Clemens Bren-
tanos schöne Worte sagen:
„O Stern und Blume, Geist und Kleid,
Lieb, Leid und Zeit und Ewigkeit.“
Daß gleichwohl nicht jede Zeit gleichmäßig zur Kunstentfaltung
befähigt und bestimmt ist, steht fest. Das liegt aber nicht zuerst an
den Stoffen und den gesellschaftlichen Zuständen, welche die Stoffe
darbieten, selbst, sondern — so muß es aufgefaßt werden — mehr
daran, daß dieselbe Zeit, die bestimmte gesellschaftliche auch be-
stimmte kunstfeindliche Zustände schafft. Es sind vom Geiste selbst-
erzeugte Entwicklungskräfte, die hier wie da zur Wirkung kommen,
es ist die g e i s t i g e R i c h t u n g d e s L e b e n s , die im
gesellschaftlichen Kreislauf wieder zurückkehrt.









