
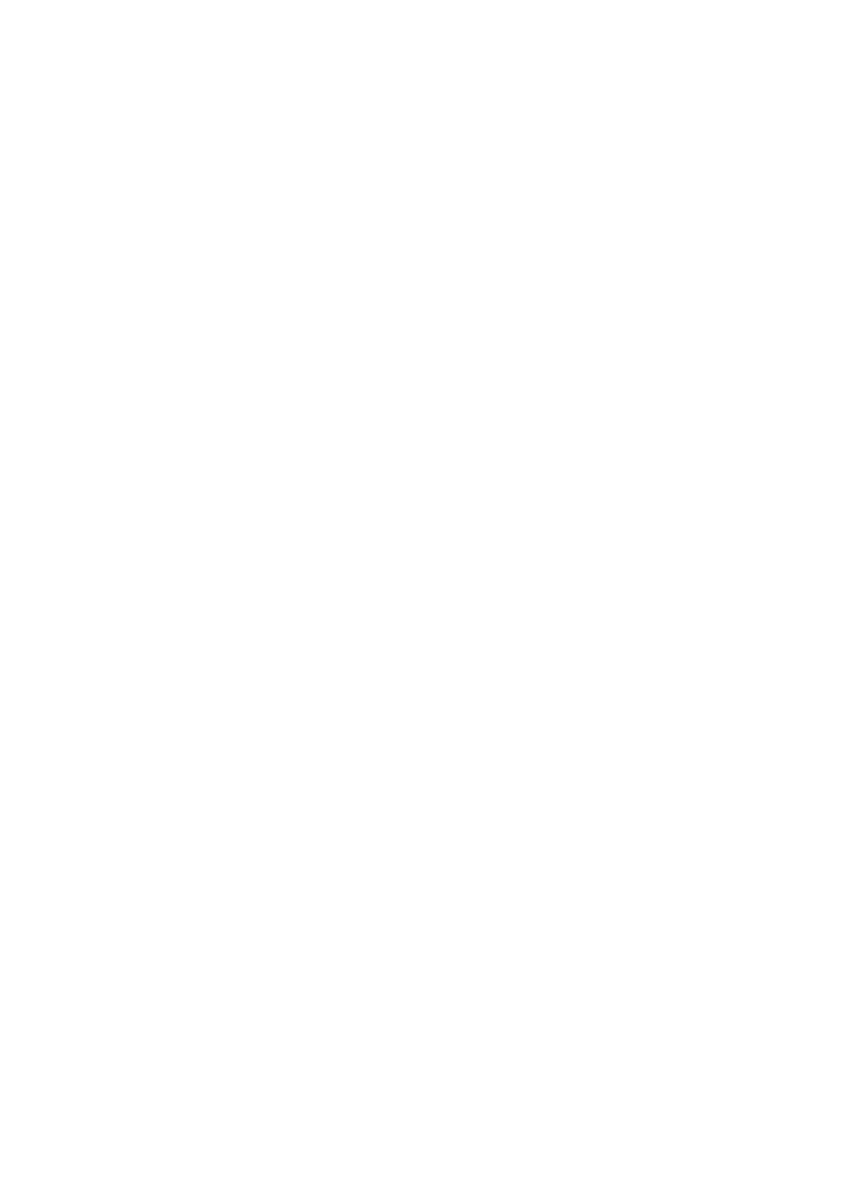
[221/222]
315
heit. In der Ganzheit ist erste Gründung und ihr folgende Entfal-
tung. Die Ganzheit gliedert sich darnach keineswegs nach dialek-
tischer Weise aus, / also keineswegs in einer ersten Setzung, welche
zugleich die leerste, die noch unbestimmteste sein muß (da erst
auf sie die Entgegensetzungen und synthetischen Zusammensetzun-
gen folgen können); vielmehr muß die Ganzheit sogleich als Ganz-
heit erscheinen, sie muß gegründet werden. Die erste Tat der Aus-
gliederung der Ganzheit ist eine schöpferische Tat, welche als Ur-
schöpfung der Welt oder als abgeleitete Schöpfung innerhalb der
Welt — z. B. Geburt des Menschen, Entwurf eines Kunstwerkes,
eines Begriffes, eines Lehrgebäudes durch Eingebung (Intuition) —
welche in diesen und allen anderen Formen nur denkbar ist als
eine einmalige Tat, in welcher schöpferische Gründung beschlossen
liegt. Diese ist eine absolute bei der Urschöpfung der Welt (bei je-
dem gedachten Uranfang) und eine abgeleitete (das heißt zuletzt
eine Tat der Umgliederung, die an Früheres anknüpft) bei aller
anderen Schöpfung durch Mensch oder Natur.
2. Die S c h e i d u n g s w e i s e d e r E i n h e i t i n d i e V i e l -
h e i t : A u s g l i e d e r u n g s o r d n u n g
Eine entscheidende Frage, welche der Lehrbegriff jeder idealisti-
schen Philosophie zu beantworten hat, ist die nach dem Wesen der
Unterschiedenheit, „Differenz“, des Endlichen voneinander; durch
sie wird mittelbar auf die noch um eine Schichte tiefer liegende
Frage Licht geworfen, welche man herkömmlich als „Scheidung der
Einheit in die Mannigfaltigkeit“ zu bezeichnen pflegt und die Ge-
burt des Endlichen aus dem Unendlichen bedeutet.
Hier zeigt sich die ganzheitliche Auffassung, indem sie die Schei-
dung als „Ausgliederung“ bestimmt, statt als bloße Aufeinander-
folge, der dialektischen in mehr als einer Hinsicht überlegen.
Erstens: Der Begriff der „Ausgliederung“ und der „Ausglie-
derungsordnung“ enthält keine Spur und Möglichkeit der vorhin
erwähnten mechanischen Auffassung der dialektischen „Teilung“,
„Aufspaltung“, „Entzweiung“ der Einheit in die Vielheit. Denn
während in der Dialektik die Unterschiede („Differenzen“) nur aus
dem Gegensatze und Widerspruche gewonnen werden (was, wie
sich zeigte, mechanisch aufgefaßt werden kann), sind die Unter-









