
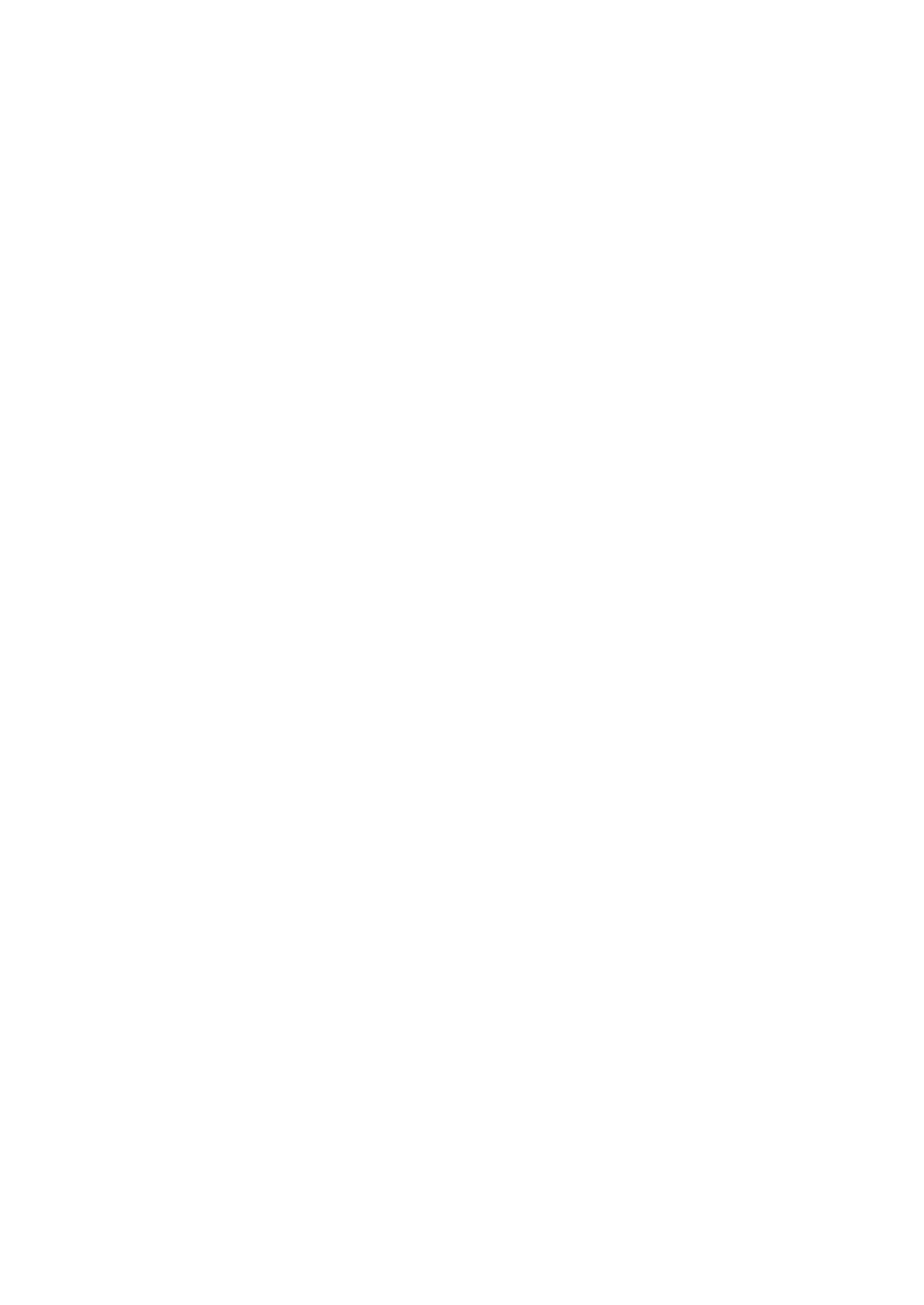
198
[178/179]
hohe Stellung, die später der römische rex s a c r o r u m , der „Opferkönig“,
einnahm. Er hatte in der Republik die geistlichen Obliegenheiten des ehemaligen
Königs weiter zu vollziehen.
Das Gottesgnadentum der Neuzeit ist noch ein schwacher Abglanz des alten
Glaubens unmittelbarer Gottverbundenheit des Herrschers — des metaphysischen
Weisen als des Herrschers.
2.
Aus der Kategorie der Einheit von Gott, Seelengrund und
Weltgrund ergeben sich alle jene Mythen, welche dem ebensowohl
hermetischen wie auch schon sumerischen Grundsatz „wie oben, so
unten“ entsprechen
1
. Konkretisiert finden wir diesen Grundsatz
überall dort, wo in irgendeiner Form d i e T h e o m o r p h i e d e r
W e l t dargestellt wird
2
.
Zunächst gehört hierher wieder der Mythos vom makrokosmi-
schen Menschen oder Urmenschen, sofern dieser nämlich nicht nur
selbst als theomorph, sondern auch als Vorbild oder als S e e l e
d e r W e l t , sogar, naturalistisch gefaßt, als Stoff der Welt er-
scheint (wenn aus seinen Körperteilen Weltteile entstehen).
Vor allem aber sind nach der Kategorie der Einheit von Gott
und Welt alle K o s m o g o n i e n a l s T h e o g o n i e n gebildet.
Denn diese, welche alle Völker haben, sind nicht, wie Jeremias,
Seeliger
3
und andere mehr meinen, aus Natur- oder aus Tages- und
Jahresmythen hervorgegangen, sondern beruhen auf inneren geisti-
gen Notwendigkeiten des mystisch-religiösen Lebens. Die naturali-
stische Anwendung dieser Kategorien ergibt die Vorstellung, daß
Gott in Teile, welche die Welt darstellen, auseinandergehe. / Die
Glieder der Gottheit bilden dann die Welt. Oder diese geht aus
einem Weltteil hervor
4
.
Daß Götter und Menschen eines Stammes seien, ist hier die
Grundlage für die V e r g ö t t l i c h u n g d e r W e l t selbst; wenn
sich auch natürlich ein dualistisches Element, wonach die bösen
1
Siehe oben S. 160.
2
Die Theomorphie des Menschen aus der Gottverwandtschaft folgend, wurde
schon oben S. 195 berührt.
3
Emil Seeliger: Artikel Weltschöpfung, in Wilhelm Heinrich Roscher: Aus-
führliches Lexikon der griechischen und römischen Mythologie, Bd 6, Leipzig
1924—27, S. 431.
4
Siehe Emil Seeliger: Artikel Weltschöpfung, in Wilhelm Heinrich Roscher:
Ausführliches Lexikon der griechischen und römischen Mythologie, Bd 6, Leipzig
1924—27, S. 498 ff. und Artikel Theogonie.









