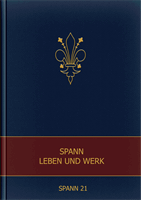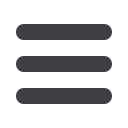

297
die Dinge an sich werden geleugnet, sondern ihre Erkennbarkeit.
Nimmt somit Kant eine Ausgangsposition ein, wie wir sie schon bei
Hobbes vorgefunden haben, so ist die S c h e l l i n g s mit jener
Berkeleys insofern vergleichbar, als beide nur das Geistige aner-
kennen. Während aber bei diesem der Geist die Natur gleichsam ver-
schluckt und dadurch aufhebt und vernichtet, will Schelling auch
die Natur selbst als durchaus geistbestimmt verstanden wissen.
Ewig wahr bleibt an K a n t e n s Lehre von den apriorischen
Anschauungsformen, daß der Geist nur seinesgleichen erkennen
kann — „Der Geist verkehrt nur mit sich selbst“ (Bd 14, 124) —
und daß er dazu nur durch eigene Tätigkeit, durch Selbstsetzung
im Sinne F i c h t e s , imstande ist. Wahr ist auch der große Ge-
danke S c h e l l i n g s von der Naturgeistigkeit, wonach der
Natur — so müssen wir allerdings im Sinne der Ganzheitslehre richtig-
stellen — wenn nicht der reine Geist, so doch etwas Geistartiges
zugrunde liegt. Aber Kant bleibt auf halbem Wege stehen, wenn
er den Raum auf den Geist beschränkt und übersieht, daß es ja nur
die eine Komponente des Erkenntnisprozesses ist, mittels welcher der
„Eindruck von außen“ in einen innerlichen transformiert wird.
Schelling hingegen hat in einem allzu kühnen Aufschwunge den
Boden unter den Füßen verloren und hat das, was von innen kommt,
das Geistige, in die Außenwelt hineingetragen, die Natur ebenfalls
zu reinem Geist erhoben.
Die G a n z h e i t s l e h r e erkennt in jedem das Seine, im
Menschen den Geist, der sich nicht in gleicher Weise wie die Natur
verräumlichen kann (denn sonst bedürfte der Bildhauer nicht des
Steins und des Meißels, um das Kunstwerk im Raum darzustellen),
in der Natur die Verräumlichungskraft; in der Natur den aus dieser
Kraft erzeugten und ihr Wesen ausdrückenden Natur-Raum, im
Geiste die ihm gemäße Entsprechung, den von ihm selbst geschaf-
fenen „Geist-Raum“. Und nicht anders verhält es sich mit den
Eigenschaften der Dinge. Denn diese sind weder raum- noch eigen-
schaftslos, der Geist aber kann ihre Eigenschaften nur seiner Art
gemäß wahrnehmen, indem er sie in seiner Weise umformt und
dadurch erst zu Sinnesempfindungen macht. Dazu bedarf es seiner
eigenen Tätigkeit, der Selbstsetzung („Einbildungskraft“).
So enthüllt sich uns durch die Ganzheitslehre der Wahrheitsgehalt