
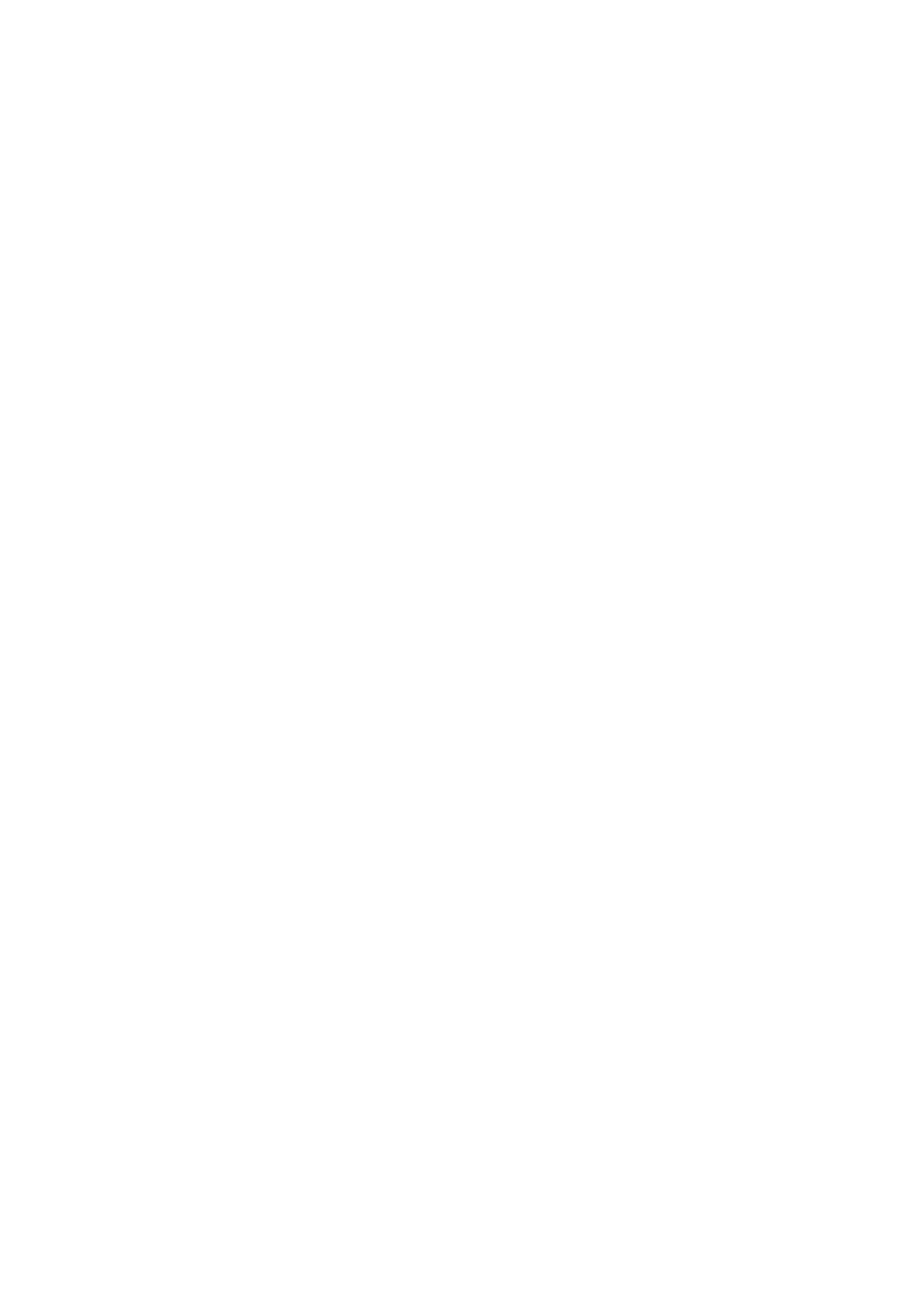
[81/82]
105
II. Die Herrschaftslehre
Die zweite Art individualistischer Auffassung wird durch die Theorie
Machiavellis am reinsten zum Ausdruck gebracht. Machia- velli faßt den
Staat als Herrschaftsverhältnis der Individuen auf, indem er in seinem
Bestand eine nackte Tatsache / der Unterwerfung erblickt. Folgerichtig
heißt er darum die Fürsten, dieses reine Herrschaftsverhältnis, mit allen,
auch unmoralischen Mitteln aufrechterhalten. „Jemand, der es darauf
anlegt“, so sagt er im „Fürsten“, „in allen Dingen moralisch gut zu handeln,
muß unter einem Haufen, der sich daran nicht kehrt, zugrunde gehen.
Daher muß ein Fürst, der sich behaupten will, sich auch darauf verstehen,
nach Gelegenheit schlecht zu handeln . . . “ Der Staat und jedes
gesellschaftliche Verhältnis überhaupt erscheint so als dauernde
Unterwerfung des Besiegten durch einen Sieger. Eine sittliche Natur kann
diesem staatlichen Verhältnis nicht eigen sein — ein Zustand, der ja in
einigen
Vorgängen
der
R e n a i s s a n c e z e i t
annähernd
Verwirklichung fand. Hier hat auch der Lehrbegriff von der
„Ausschaltung der Moral aus der Politik“ seinen Ursprung. „Ich wage es zu
behaupten“, sagt Machiavelli, „daß es sehr nachteilig ist, stets redlich zu
sein; aber fromm, treu, menschlich, gottesfürchtig, redlich zu scheinen, ist
sehr nützlich.“ — Die vielen Versuche, aus Machiavelli doch den
humanen Idealisten herauszuholen, sind erfolglos. Das sollte man sein
lassen. Der Lehre Machiavellis entsprach sein Charakter ganz.
Auch im Altertum war die nackte Machtlehre schon entwickelt. Thukydides gibt uns von
dieser und von der Verwilderung im Peloponnesischen Kriege ein Denkmal in dem
berühmten Gespräch der Athener mit den Meliern. Letztere, von den Athenern zur
Unterwerfung aufgefordert, antworteten, sie würden lieber auf Gott und die Hilfe der ihnen
stammverwandten Lakedaimonier vertrauen. Worauf die Athener ohne Scham und Scheu
erwidern: „Wir meinen, daß, wie die Gottheit nach gläubiger Vorstellung, so der Mensch
handgreiflich kraft eines zwingenden Naturdranges ü b e r a l l ü b e r d i e j e n i g e n
h e r r s c h e , d e n e n e r a n M a c h t ü b e r l e g e n i s t . Nach diesem Gesetze
richten wir uns ..."
1
1
T h u k y d i d e s : Geschichte des peloponnesischen Krieges, V. Buch, 105, 1, 2.
„
η
ϒ
ούμεα γάρ τό τε θεϊον δόξη, τό άνθρώπεών τε σαφώς
διά
παντός ύπό φύσεως
άναγκαίας, ού αν κράτη, άρχειν καί ήμεϊς ούτε θέντες τον νόμον
...“
Vgl. jetzt Adolf
Menzel: Kallikles, Eine Studie zur Geschichte der Lehre vom Rechte des Stärkeren, Wien
1922.









