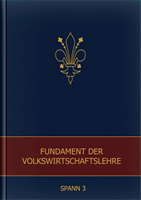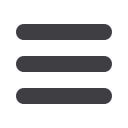451
geschlossene Lehrbuch der ganzheitlichen Wirtschaftswissenschaft hätte
werden können, das die erreichte innere Entfaltung an sich bereits
ermöglicht hätte.
Diese auch für die innere Geschichte des Buches bedeutungsvolle
Tatsache ist auf den äußeren Umstand zurückzuführen, den Othmar Spann
gleich in den ersten Zeilen seines Vorworts zur vierten Auflage erwähnt:
daß nämlich der Verlag in Erwartung eines weiteren raschen Absatzes des
Buches, das ja 1921 in der zweiten und 1923 in der dritten Auflage
erschienen war, den größten Teil der vierten Auflage im voraus gedruckt
hatte. So konnte Spann in dieser vierten Auflage, die dann infolge des
Rückganges des Buchabsatzes in und nach der deutschen Inflation erst 1929
herauskam, außer dem Titelbogen nur sechs Bogen neu bearbeiten (Bogen
6, das sind § 6, Punkt 3, 4,
5,
und die §§ 7—9, S. 81—96; die Bogen 9 und
10, das sind § 18, Punkt 3, 4, 5, und die §§ 19—20, S. 129—160; Bogen 12,
das sind § 23, II—V, und § 24, A, S. 177—192; Bogen 14, das sind § 28,
Zweiter Unterabschnitt, und die §§ 29—30, Punkt 3, S. 209 bis 224; sowie
endlich Bogen 24, das ist der Schluß der Antrittsrede „Vom Geist der
Volkswirtschaftslehre“ und das „Sachverzeichnis“ S. 369 bis zum Ende).
Inzwischen aber hatte Othmar Spann seine Lehre von der
Ausgliederungsordnung oder dem sachlich-inhaltlichen Bauplan der
Wirtschaft erweitert und diese fortbildenden Arbeiten auch veröffentlicht:
in der Abhandlung „Die Ausgliederungsordnung der Wirtschaft und ihre
Vorrangverhältnisse“
1
(1924), dann erweitert abgedruckt in „Tote und
lebendige Wissenschaft“ (zweite Auflage 1925).
Besonders aber hatte Othmar Spann die ganzheitliche
Leistungsgrößenlehre, also die Wert- und Preislehre, weiter entfaltet und
im Zuge dieser Weiterentwicklung seine ursprünglichen Versuche
aufgegeben, „den Grenzwertgedanken in der peripheren Stellung, die ihm
nun“ — in der ganzheitlichen Nationalökonomie mit ihrem Vorrang der
Leistungslehre — „zugewiesen wurde, nämlich für die (durchaus nur
periphere) Leistungsgrößenerklärung, nutzbar zu machen“
2
. Dieser
Grenzwertgedanke erwies sich immer mehr — trotz gewisser
ganzheitlicher Einschläge, die etwa von den Lehrstücken Heinrich von
Thünens her beleuchtet werden könnten, — als ein Fremdkörper im
ganzheitlichen Begriffsgebäude.
Auch über diese seine neue Auffassung der Wert- und Preislehre hatte
Othmar Spann inzwischen abgehandelt in „Gleichwichtigkeit gegen
Grenznutzen, Grundlegung der Preis- und Verteilungslehre“
3
(1925), er
1
Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, Jena 1924, Bd 122 (= Dritte Folge,
Bd 67), S. 721 ff.
2
Vorwort zur 4. Auflage, oben S. 4.
3
Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, Bd 123 (= dritte Folge, Bd 68), Jena
1925, S. 289 ff. — Auch in „Die Lösung der Wert- und Preisfrage aus der Ganzheitslehre“,
in: Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, Bd 130 (dritte Folge, Bd 75), S. 321 ff.