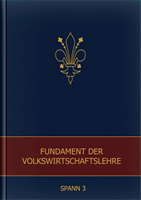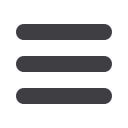(46/47)
63
werden. Die ursächlich beste und restloseste Erreichung des Zieles, das
vollkommenste „Wie“ muß angestrebt werden, Sparen und alle anderen
wirtschaftlichen Rücksichten treten in den Hintergrund.
Umgekehrt gibt es als Grenzfall auch eine Wirtschaft fast ohne
Technik. So wenn die Hausfrau haltbare genußreife Obstvorräte nach
wirtschaftlichen Gesichtspunkten zum Verbrauche in verschiedenen
Zeitpunkten einteilt. Hier ist keine technische Aufgabe mehr zu lösen.
Ähnlich tritt auch das technische Moment zurück, wenn der Kapitalist
entscheidet, ob er seine Gelder in der Bank A oder B anlegen soll;
ebenso bei Kauf und Verkauf aller Art, z. B. von Effekten.
Solche Fälle sind allerdings nur Grenzfälle. Sie beweisen aber, daß
Wirtschaft und Technik innerlich niemals zusammenfallen können und
stets arteigenen Gesetzen gehorchen. In der geschichtlichen
Wirklichkeit sind aber beide aufs innigste verknüpft. Alle wirkliche
Technik ist Wirtschaftstechnik, ist an die Voraussetzung gebunden, daß
die (ursächlichen) Mittel „wirtschaftlich“ verfügbar sind, daß nämlich
die Zielerreichung wirtschaftlich richtig sei. Die Wirtschaft wieder
kann sich nur innerhalb des technisch Möglichen bewegen.
Mit dem Verhältnis zwischen Wirtschaft und Technik steht es
danach so, daß neue wirtschaftliche Gestaltungen vorhandene
Techniken auf neue Weise ausnützen und damit der Entwicklung der
Technik einen Anstoß geben. So bei der Zusammenlegung von
Betrieben, der „Betriebskonzentration“, welche neue Arbeitsteilung,
neue Abfallverwertung und dergleichen schafft; so namentlich bei
Einführung gewisser Typen und Muster als Massenartikel, was für die
Technik „Spezialisierung“ und damit Vervollkommnung bedeutet; so
bei Übergang zu anderen, schon bekannten Verfahren, die nun durch
die
Massenanwendung
vervollkommnet
werden.
Die
Vervollkommnung des Luftschiffbaues z. B. hätte ohne die
Massenerprobung der Motoren in der wirtschaftlichen Praxis der
Automobilverwendung nicht so schnell vor sich gehen können, wie es
wirklich geschah. Ein anderes Beispiel ist die ganze „Ersatz“-Technik
im Kriege, zu / der die Wirtschaft den Anstoß gab, indem sie wichtiger
gewordene Ursächlichkeiten (z. B. Rohstoffe) für unwichtige Zwecke
nicht mehr verwenden konnte und daher nach minder wichtigen
Ursächlichkeiten („Ersatzstoffen“) griff; ein Gleiches zeigt die bekannte
Erscheinung der Einführung von Maschinen bei steigenden
Arbeitslöhnen. — Umgekehrt schaffen neue Ursächlichkeiten, das