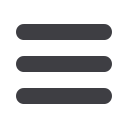[194/195]
239
higt ihn, sich sogar im Staate als Herrscher einzurichten, um die von
ihm geschaute Idee des Guten zu verwirklichen. Er behält das Gött-
liche im Auge, ohne die Dinge selber zu verlieren.
Bis zu dieser äußersten Grenzscheide, die noch möglich ist, um die
Wirklichkeit festzuhalten und sie doch zu überhöhen, geht Platons
Abgeschiedenheitslehre; weiter nicht. So entspricht es auch ganz der
plastischen Natur des Griechentums, welche zwischen innerwelt-
licher, immanenter Befangenheit und jenseitiger Mystik die reinste
Waage hielt und daher nicht wie Inder und Germanen in Mystik
und Philosophie, sondern in der Kunst ihren höchsten Kulturaus-
druck fand.
Eine gleiche Stellung nimmt A r i s t o t e l e s ein. „Es ist nicht richtig, daß es
besser sei, das untätige Leben vor dem tätigen zu leben; denn die Glückselig-
keit ist Tätigkeit“
(„ή
κάς εϋδαιμονία πσάξις έστίν“)
1
.
— „Allein dies tätige
Leben braucht nicht notwendig auf andere gerichtet zu sein. .. und nicht die
Gedanken allein sind praktischer Natur, welche auf die Erfolge des Handelns
gerichtet sind, sondern in weit höherem Grade sind es diejenigen Betrachtungen
und Gedanken, welche in sich selbst ihren Zweck haben und um ihrer selbst
willen angestellt werden.“
2
/
C. Das C h r i s t e n t u m
Welche gesellschaftstheoretische Anschauung liegt dem Christen-
tum zugrunde? Nach herrschender Auffassung im Grunde eine indi-
vidualistische. Der ausgebildete Unsterblichkeitsgedanke, verbun-
den mit der Willensfreiheit, soll einen individualistischen Grund-
zug ergeben, indem er dem Einzelnen unumstößlichen Wert und
Autarkie zuspreche. Man sagt, das Christentum habe den Indivi-
dualismus recht eigentlich erst in die Welt gebracht, weil nach ihm
jeder Einzelne seine unsterbliche Seele in unmittelbare Beziehung
zu Gott setzt. — Von den Sittengeboten dagegen ist es von Anbe-
ginn einleuchtend, daß sie universalistisch sind, indem sie Liebe und
Aufopferung (Demut) gebieten; die Weltflucht, welche sich auf die
Sündhaftigkeit der Dinge stützt, daher zugleich nach asketischer
Form trachtet, zeigt hinwieder Abgeschiedenheit an.
Wie gegenwärtig diese Frage behandelt wird, dafür scheint mir
1
Aristoteles: Politik, Ausgabe Susemihl, Viertes Buch, Kapitel 3, § 2b.
2
Aristoteles: Politik, Ausgabe Susemihl, Viertes Buch, Kapitel 3, § 5.