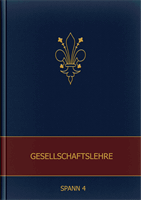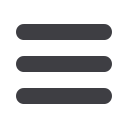364
[300/301]
die bewußte Zerstörung des Schönen durch Unnatur und Herausfor-
derung. — Die „Eleganz“ schließt außer der Unnatur auch eine
Schwäche im Schönen in sich. Daher das Kalte, Geschminkte aller
Eleganz. Sie gleicht dann dem Tätowieren, das ein unheimlich Leb-
loses an sich hat. (Anders das echte Tätowieren der Naturvölker, das
auf Zauber beruht.)
Die Kunst ist endlich auch nicht „idealisierend“, im Sinne will-
kürlicher oder tendenziöser Umgestaltung der Wirklichkeit nach den
persönlichen Wünschen des Künstlers oder Zuhörers, nämlich senti-
mental, empfindelnd, schönfärberisch, predigend usw.; und ebenso-
wenig ist sie „moralisierend“ im Sinne von „tendenzhaft“, von
„Tendenzkunst“
1
. Denn echte Kunst hat selbst in sinnbildlicher
Form („Symbolismus“) ihren vollen Wirklichkeitsgehalt, ist zu
jeder Zeit und in jeder Gattung „Verdichtung“ der Wirklichkeit,
wie es das oben angeführte Wort Meister Tiecks so tiefblickend be-
zeichnet. Als schönfärberisch und absichtsvoll aber wäre sie dünn
wie Wassersuppe.
Die Stellung der Kunst im menschlichen Leben ist also weder
durch Unterhaltung noch subjektive Täuschung noch Eleganz
noch auch tendenzhafte Sittenpredigt und schönfärberische Idealisie-
rung des Lebens bezeichnet.
Die Antwort auf die Frage, was die Kunst wirklich bedeutet und
ihrer Natur nach ist, wird in der Gesellschaftslehre je nach indivi- /
dualistischem oder universalistischem Standpunkte verschieden aus-
fallen. Jener Gesellschaftsforscher, der die Kunst individualistisch
und empiristisch betrachtet, muß eine andere Antwort geben als
jener, der sie universalistisch und nicht-empiristisch betrachtet. Die
empiristisch-individualistische Antwort haben wir oben angedeu-
tet
2
. Ehe wir die Rolle der Kunst in Gesellschaft und Leben nach
nicht-empiristischer und universalistischer Auffassung begrifflich
bestimmen, lassen wir zuerst Beispiele sprechen.
Unsere Jugend schöpft aus der Siegfriedsage und ihren Dichtun-
gen die Idee des lichten Helden, des furchtlosen und reinen Strei-
ters, der zwar den dunklen Mächten erliegt, aber nicht ohne Hoff-
nung auf den endlichen Sieg des Guten. Jeder rechte Junge erfährt
dieses in sich, auch ohne Reflexion und ohne Auslegung durch den
1
Darüber später mehr.
2
Siehe S. 359 f.