
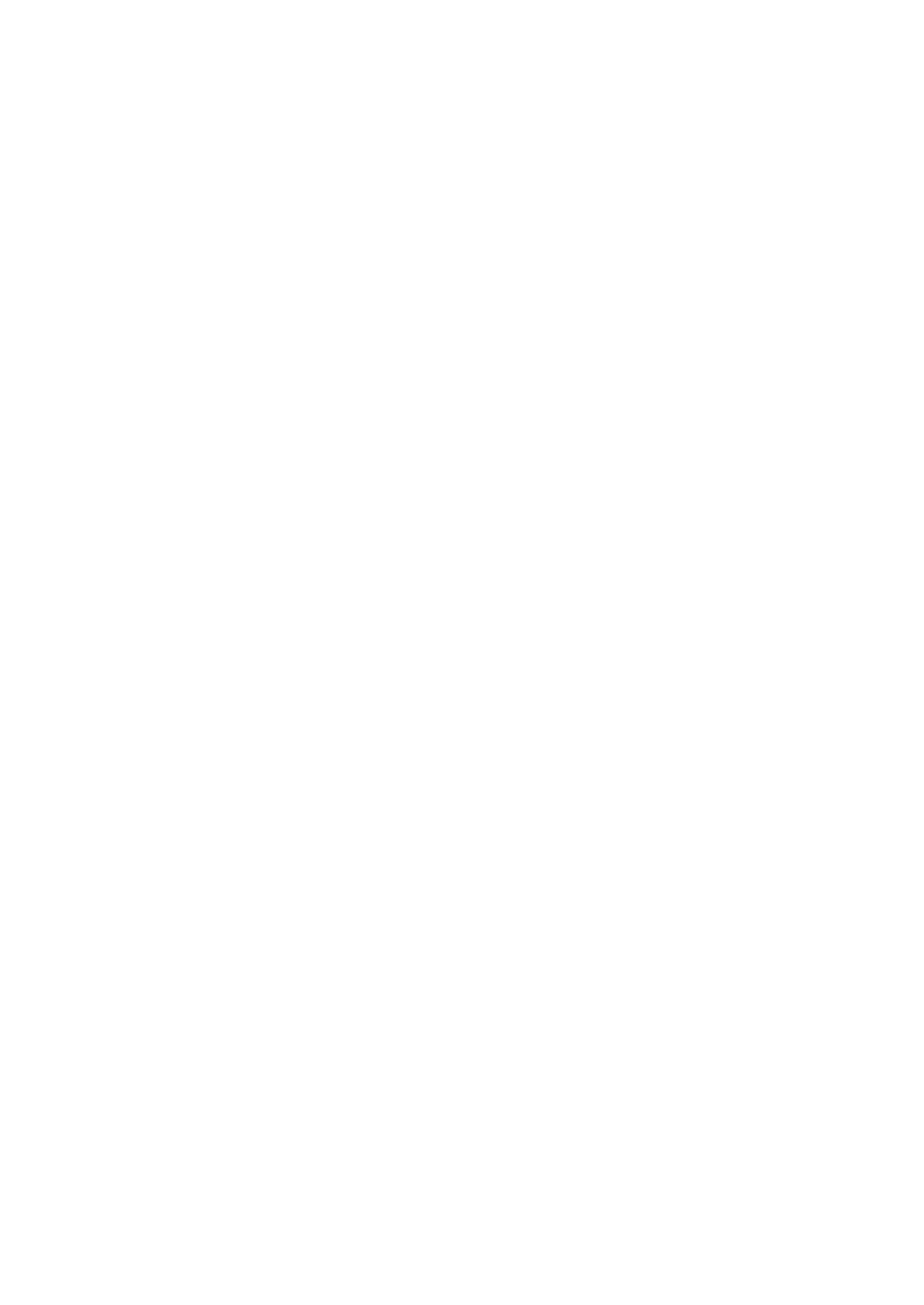
[500/501]
447
nicht für sich selbst etwas Wirkliches, keine eigene Wesenheit. —
Im organischen Leben ist dies handgreiflich. Die geometrischen
Muster, die zum Beispiel die Radiolarien bilden, sind das Ergebnis
ihres Lebensrhythmus. Das Seelische, Lebendige der Radiolarien
gliedert sich niemals in Gestalten aus. Die vegetative Seele oder
Lebensidee der Radiolarien selbst können sich ebensowenig ver-
räumlichen wie der menschliche Geist. Aber dasjenige, was den
inneren Lebensrhythmus, was die eigene Lebensmelodie des Seelisch-
Lebendigen in den Radiolarien ausmacht, bildet in seiner räum-
lichen E n t s p r e c h u n g die Gestalt. Dagegen umgekehrt: Alles
was sich selbst verräumlicht, was in Ausdehnung übergeht, gehört
nicht mehr zum Seelischen, Geistigen, daher nicht mehr zur Ideen-
welt.
Ebenso sind die Gestalten, welche Pflanzen und Blumen bilden,
die Ergebnisse ihres Lebensrhythmus. Was das Leben des Geistes im
Bereiche der Gezweiung höherer Ordnung mit dem Stoffe innerlich
ist, bringt es durch die Verleiblichung nach außen zur Darstellung.
Denn nun ist der Geist durch diese Gezweiung unmittelbar mit
jener Äußerlichkeit, dem verräumlichten Stoffe, verbunden, die er
selbst nicht in sich hat und die er selbst niemals werden kann.
Der Geist und das Leben haben in sich selbst keinen Weg / zu
den räumlichen Gestalten, aber sie erlangen diese erst durch Ent-
sprechung, das heißt in der Gezweiung mit den überstofflichen An-
fängen des Stofflichen und Räumlichen.
Hiermit ist auch das V e r h ä l t n i s d e s K u n s t s c h ö n e n u n d d e s
N a t u r s c h ö n e n erklärt, das übrigens von der romantischen Psychologie
(Schelling) längst ins rechte Licht gesetzt war: Weil die organischen Natur-
wesen als Darstellung der Idee erscheinen, und insoferne sie dies tun, erscheinen sie
als schön. Sofern die Schöpfungen des Künstlers gleichfalls die Selbstdarstellung
der Idee im sinnlichen Gegenstande festhalten, erscheinen sie als schön. Nur in
diesem m i t t e l b a r e n Sinne kann der Künstler die Natur „nachahmen“ (wor-
in nach Aristoteles vornehmlich die Kunst bestehen soll), nicht aber geradeswegs.
Denn auch der N a t u r g e g e n s t a n d m u ß i m K ü n s t l e r s e l b s t
z u e r s t z u r E i n g e b u n g geworden sein, bevor er das Ideenhafte in ihm
erleben und es in seiner eigenen Gestaltung weitergeben kann. Nicht die Natur
schafft der Künstler nach, sondern seine eigene Vision, die Idee hinter der Natur.
In dieser allein auch läutert und reinigt und erhöht er die Natur. Sie wird in der
Kunst veredelt. — Vgl. dazu den oben
1
entwickelten Unterschied der elementa-
ren Gestalt und der Ausdrucksgestalt. Nur letztere ist im geistigen Sinne „schön“.
1
Siehe oben S. 331 f.









