
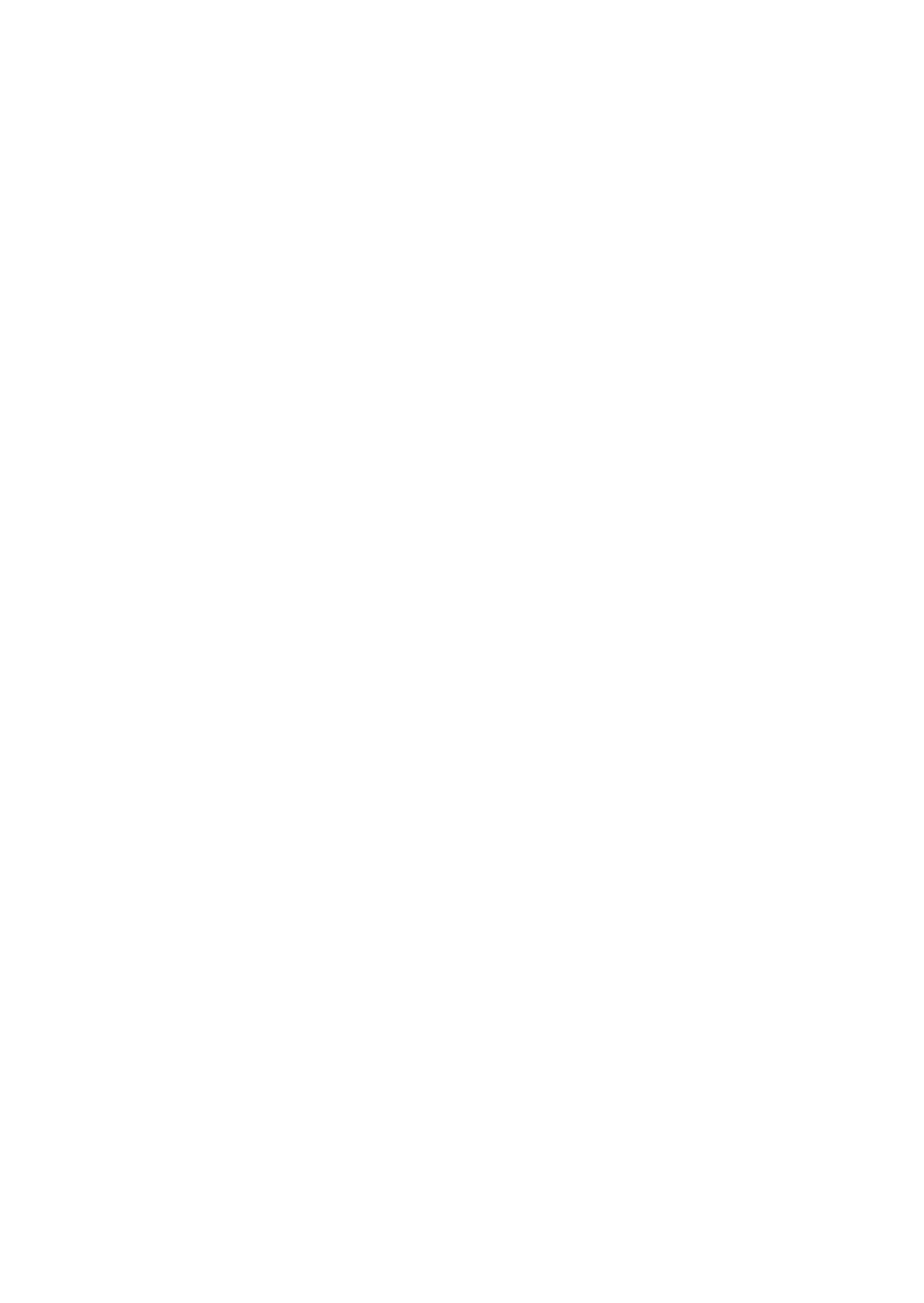
24
[17/18]
Ehe wir in die Erörterung des eleatisch-heraklitischen Gegen-
satzes eintreten, schicken wir zum Bescheide eine kurze Erinne-
rung an die Hauptbegriffe, die in der Seinslehre ausgebildet wurden,
voraus, da sie dem heutigen philosophischen Bewußtsein fast ab-
handen kamen. Sie stammen größtenteils von Aristoteles, wurden
von der Scholastik fortgebildet und stehen bis zu Schelling, Hegel
und zur Neuscholastik in Geltung
1
.
Erstens. Von alters her gilt das Sein als der einfachste Begriff, der von allem,
was möglich und wirklich ist, ausgesagt werden kann; der selbst kein Merkmal
hat, in dem aber jedes Merkmal liegt. In dieser Eigenschaft steht er über den
Gattungsbegriffen, auch über den höchsten, den Kategorien, und wird darum
„transzendenter Begriff“ genannt. Zugleich gilt er als der allgemeinste Begriff
und darum ist in ihm kein Unterschied. Das Sein hat keine Arten, sagen Aristote-
les und die Scholastik; Sein ist die Abstraktion von aller Bestimmtheit, sagt
Hegel. Wo ist, so fragt man, im Sein ein Unterschied, da es doch allem, was nur
immer denkbar ist, zum Beispiel Mensch oder Stein, gleichermaßen zukommt?
Zweitens sagt die herrschende Lehre, es müsse zwischen Wesenheit (essentia)
und Dasein (esse) unterschieden werden. Denn im Wesen des Menschen zum Bei-
spiel liegt nur die Möglichkeit, daß er sei, aber zu dieser / Möglichkeit muß das
Dasein erst hinzukommen, damit jene wirklich werde. (Aristotelisch-scholastische
Unterscheidung von „W a s es ist“ und „d a ß es ist“, die auch bei Kant und be-
sonders bei Schelling hervortritt.) Die Wesenheit ist nur das Mögliche, das Da-
sein ist das Wirkliche. Nur bei Gott, so betont die Scholastik, sind Wesen und
Dasein einerlei (esse per essentiam, ens a se), bei den Geschöpfen ist das Dasein
verliehen (ens ab alio, esse per participationem)
2
.
Drittens wäre noch der von Schelling in den „Weltaltern“ im Anschlusse an
den „Sophistes“ von Platon besonders ausgebildete Begriff des „beziehungsweise
Nicht-Seienden“ hervorzuheben. Das einander widersprechende A und Non-A,
sagt Schelling, kann einem und demselben Dinge sehr wohl zukommen, nur kann
es beides nicht zumal (gleichzeitig) in Wirksamkeit treten lassen. Jede Indivi-
1
Vgl. für die Neuscholastik: Albert Stöckl: Lehrbuch der Philosophie,
z
Bde,
5. Aufl., Mainz 1881; Joseph Kleutgen: Die Philosophie der Vorzeit, 2 Bde,
2. Aufl., Innsbruck 1878; Joseph Geyser: Allgemeine Philosophie des Seins und der
Natur, Münster i. W. 1915. — Vgl. ferner Schelling: Sämtliche Werke, Abt. 2,
Bd 1, Stuttgart 1857, S. 272 ff. und 577 ff., in der Abhandlung über die Quelle
der ewigen Wahrheiten, wo Schellings letzte Ansichten übersichtlich beisammen
sind. — Hegel: Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse,
in 2. Auflage neu herausgegeben von Georg Lasson, Leipzig 1905, § 83 ff.
(= Philosophische Bibliothek, Bd 33). Hegel beginnt mit dem leeren Sein, er
nimmt also die Unterschiedslosigkeit von „Sein“ an. — In Fichtes Wissenschafts-
lehre ist Sein bloß eine Kategorie des Ich („Realität“); andererseits ein Setzen,
nicht ein Sein, aber auch als Setzen bloß formal (siehe oben S. 20).
2
Anderes an der Unterscheidung von esse und essentia ist in der Scholastik
strittig. Vgl. unten S. 100 ff. und Immanuel Kant: Kritik der reinen Vernunft,
nach der 1. und 2. Originalausgabe neu herausgegeben von Raymund Schmidt,
Leipzig 1926, S. 626 f. (= Philosophische Bibliothek, Bd 37 d).









