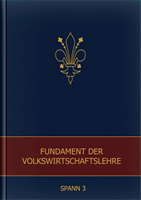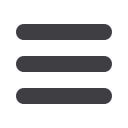(219]
257
pflegt. Als die beiden Hauptsätze der herkömmlichen Ertragslehre können gelten:
1.
daß bei noch nicht erreichtem Optimum der Leistungen jede Mehrleistung einen
überverhältnismäßig zunehmenden Ertrag (genauer: zunehmende Zielerreichung)
bringt oder doch bringen kann;
2.
daß bei überschrittenem Optimum innerhalb gewisser Grenzen jede
Mehrleistung nur unterverhältnismäßig zunehmenden Ertrag, genannt „abnehmenden
Ertrag“, bringt.
Diese Sätze sind alt und gehen auf die Zeit vor Malthus zurück
1
. Ihnen sind, wie ich
anderen Ortes begründete, noch als weitere hinzuzufügen:
3.
Das Gesetz des abnehmenden Ertrages tritt geschichtlich niemals völlig allein in
Wirksamkeit, da keine erheblichen Mehraufwände ohne jede, sei es auch nur
geringfügige, Änderung der Technik (Umbildung der Leistungsverbindungen) möglich
sind, welche zugleich ein neues Optimum schafft und dadurch zug l e i c h eine, sei es
noch so geringfügige, Wirksamkeit des Gesetzes vom zunehmenden Ertrage in sich
schließt
1 2
. Daher:
4.
Es gibt keine absoluten Optima, es gibt nur beziehungsweise Optima. Kein
Optimum steht ein für allemal fest. — Die Geschichte zeigt denn auch, daß große
rückläufige Bewegungen der Wirtschaft, wie sie z. B. in der spätrömischen Kaiserzeit für
Italien, in der Zeit vor und nach dem Dreißigjährigen Krieg in Deutschland stattfanden,
nicht auf Wirksamkeit des Gesetzes vom abnehmenden Ertrag, sondern auf politische
und kulturelle Gründe, das heißt auf Kapital höherer Ordnung und Umbau der
Weltwirtschaft, zurückgehen.
5.
Jeder Wirtschaftserfolg oder „Ertrag“ ist durch unverbrauchliche Leistungen, die
größtenteils im Preise nicht bezahlt werden, mitbedingt (Umkehrung der
Mehrwertlehre).
III. Die Fruchtbarkeit im höheren Ganzen:
Fruchtbarkeit höherer Ordnung
Wie die Leistungen niemals für sich sind, sondern stets mit anderen,
stets in Gebilden ausgegliedert, und wie die Gebilde wieder sich in
höheren Gesamtgebilden ausgegliedert finden, so können auch die
einzelnen Ergiebigkeiten nicht für sich bestehen. Eine gesteigerte
Ergiebigkeit einer einzelnen Leistung, z. B. im Ackerbau, wirkt sich auf
allen Leistungszweigen aus, der gesamte Gliederbau der Leistungen
(damit auch die Preisrechnung) wird verändert. Indem alle
1
Vgl.: Die Haupttheorien der Volkswirtschaftslehre, 26. Aufl., Heidelberg
1949, S. 71 ff. und 213 f., wo auch die Bedingungen des „abnehmenden Ertrages“ (sie
liegen in der Festlegung e i n e s T e i l e s der Leistungen) und das Verhältnis zum
zunehmenden Ertrage klargestellt sind. — Vgl. zur Ertragslehre Walter Weddigen:
Ertragstheorie und Verteilungstheorie (Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik,
Bd 128, Jena 1928), S. 1 ff.
2
Vgl. oben S. 108 f.