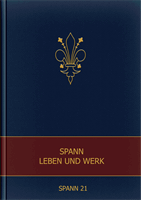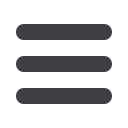

162
Den schöpferischen Meistern gegenüber haben sie eine Vorläufer-
stellung. Ihre Werke scheinen weniger genial zu sein und sind oft,
wie bei Kant, mit Gelehrsamkeit überladen. Die Erkenntnistheore-
tiker der Übergangszeit müssen aber gerade so schreiben, daß sie in
den Zeiten des empiristischen Rationalismus verstanden werden.
Empiristen von der Art der Sophisten oder eines David Hume ver-
stehen nicht die Sprache des Idealismus oder gar der Mystik. Der
gelehrte Stil eines Kant aber wird wenigstens von den Besten aus
dem Lager des empiristischen Rationalismus verstanden.
Der „Philosophenspiegel“ weist am Beispiel des hellenischen und
Deutschen Idealismus nach, daß große Epochen und Höhepunkte der
Philosophie vor allem dann möglich werden, wenn in einer bestimm-
ten zeitlichen Reihenfolge verschiedene Begabungstypen höchsten
Ranges tätig sind: am Anfang die großen Kritiker, sodann die schöp-
ferischen Meister des Idealismus, die aus einem mystischen Grund-
erlebnis heraus wirken, und zuletzt die großen Systematiker, die
das gewaltige Gedankengut ordnen, zum System festigen und lehr-
und lernhaft darstellen. Diese systematische Leistung vollbrachte
für die Antike Aristoteles, für das Mittelalter Thomas von Aquino
und für den Deutschen Idealismus Hegel. Darum finden diese Meister
auch eine sehr ausführliche Darstellung und Würdigung.
Im „Philosophenspiegel“ sind der hellenische und der Deutsche
Idealismus ausführlicher behandelt als die mittelalterliche Philoso-
phie. Das ist keineswegs darauf zurückzuführen, daß Spann diese
Epoche weniger gekannt oder geschätzt hätte. Der Universalismus
Spanns hat seinen Namen gerade von den Idealisten des Mittelalters
genommen, den Universalisten, die sich freilich meist „Realisten“
nannten, weil sie im Gegensatz zu den empiristischen Nominalisten
von der Wirklichkeit der Universalien (der Ideen) überzeugt waren.
Am Mittelalter schätzt Spann vor allem die besonders enge Ver-
bindung zur Mystik, was er an mehreren Beispielen nachweist. Aus
dieser Würdigung entstand auch sein Buch über „Die mystische
Philosophie Meister Eckeharts“ (Bd 18). Die kürzere Behandlung
der mittelalterlichen Philosophie ist wohl darauf zurückzuführen,
daß Spann ihre Hauptrichtungen (Platoniker, Aristoteliker) nicht
als philosophische Neugründungen, sondern als Entfaltungen der
hellenischen Gründung betrachtete.