
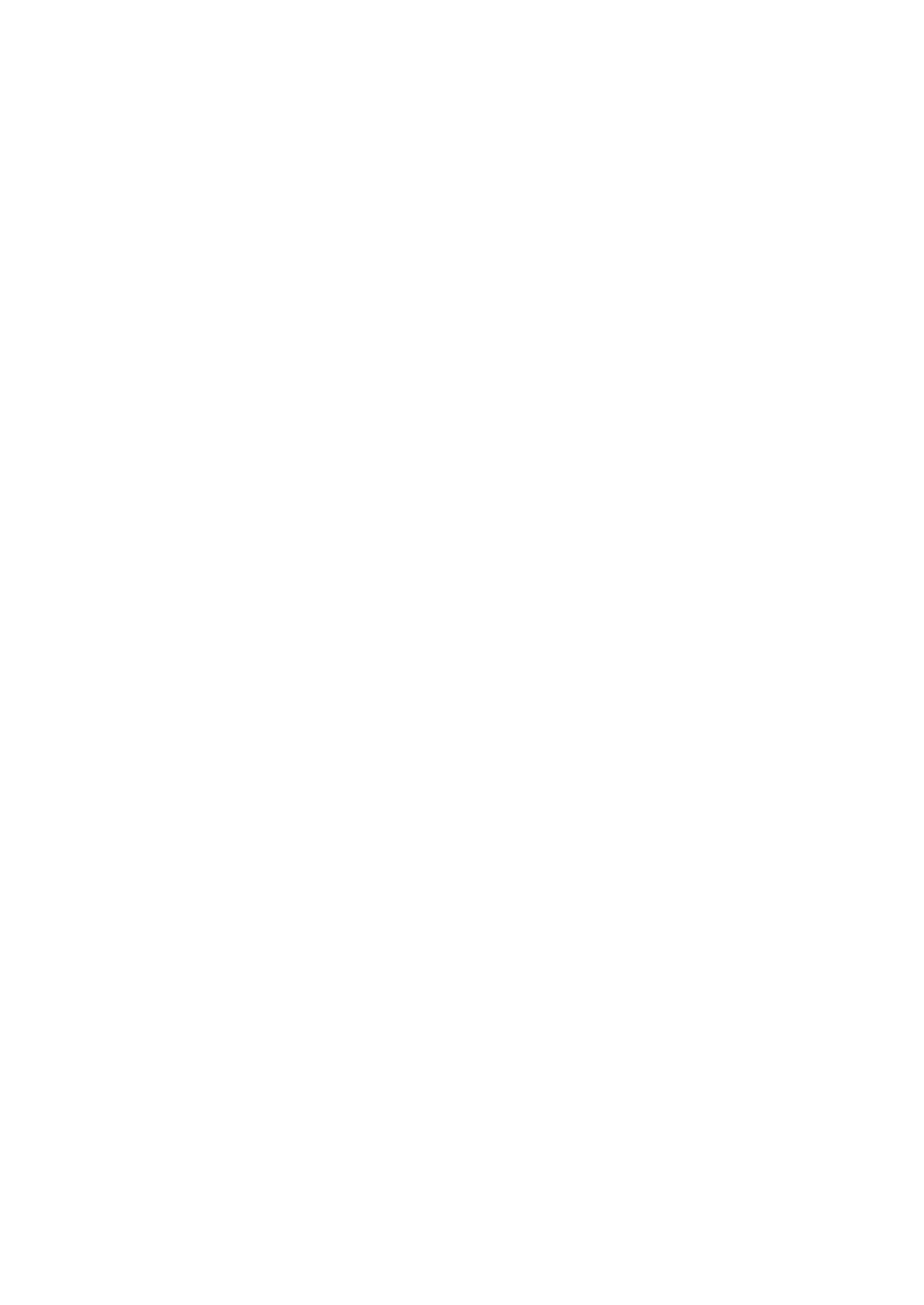
28
[22/23]
„vier Ursachen“ systematisch fortgebildet: die
causa formalis
ist das Wesenhafte,
die Form (Idee) eines Dinges; die
causa fitialis
der Zweck (nämlich die vollendete
Form); die
causa materialis
der Stoff (die Materie, das die Form Aufnehmende);
die
causa efficiens
die Überführung der Form aus der Möglichkeit in die
Wirklichkeit, die Bewegung, Veränderung. Die Bewegung ist vom Zweck, der
Vollendung der Form, beherrscht und kennt daher keine mechanischen Elemente.
— Ganz anders der neuzeitliche Ursächlichkeitsbegriff
1
.
Dieser kurze Überblick beweist deutlich, daß die aristotelische
Tafel nur eine solche der S u b s t a n t i a l i t ä t u n d i h r e r
I n h ä r e n t i e n ist, keineswegs aber eine Lehre von den Weisen
des Seienden überhaupt, keine allgemeine Kategorienlehre. Diese
zeigt sich unseres Erachtens vielmehr in der Lehre von den vier
ontologischen Anfängen. In ihr stehen, wenn man sie richtig be-
trachtet, an oberster Stelle F o r m u n d Z w e c k als methodo-
logisch miteinander eng verbundene Begriffe; sogar das vierte
Prinzip, die Bewegung (Veränderung), läuft wieder insofern auf
Form und Zweck hinaus, als diese in ihren verschiedenen geneti-
schen Stadien mit „Werden“, also „Bewegung“ zusammenfallen.
Es ist unsere Überzeugung, daß jede Kategorienlehre, von ihrer
metaphysischen Bedeutung abgesehen, zuletzt nur so viel wert sei,
als sie fähig ist, das Verfahren der Wissenschaften zu bestimmen.
Da erweist sich nun als der methodologische Haupt- / begriff der
aristotelischen Weltbetrachtung zuletzt der Zweck. Denn indem,
wie sich zeigte, Form und Zweck Zusammentreffen, bleibt die
„Form“ im ontologischen Bereiche, während „Zweck“ jener Be-
griff wird, der die wissenschaftliche Erforschung der Welt leitet. —
Der S t o f f allein bleibt nun gegen Form und Zweck als Gegen-
seite übrig. In diesem Sinn ergeben sich also zuletzt bei Aristoteles
nur zwei Urgegensätze: Zweck gegen Stoff, von denen der letztere,
als das bloß Leere und zu Bestimmende, nur uneigentlich Wirkliche,
das Verfahren der Wissenschaft nicht beherrschen kann. Für die rein
mechanistisch-kausale Auffassung der Welt im heutigen Sinn bleibt
dabei, wie ersichtlich, kein Raum. Vielmehr ist es die Betrachtung
der Welt unter dem Gesichtspunkt des Zweckes, die von Aristoteles
als beherrschender methodischer Grundsatz ausgeht, wie es denn
auch die Geschichte aller aristotelischen Wissenschaft zeigt. Dieses
darzutun, sollte der Kern unserer kurzen Betrachtung des Aristo-
teles sein.
1
Siehe oben S. 11 f.









