
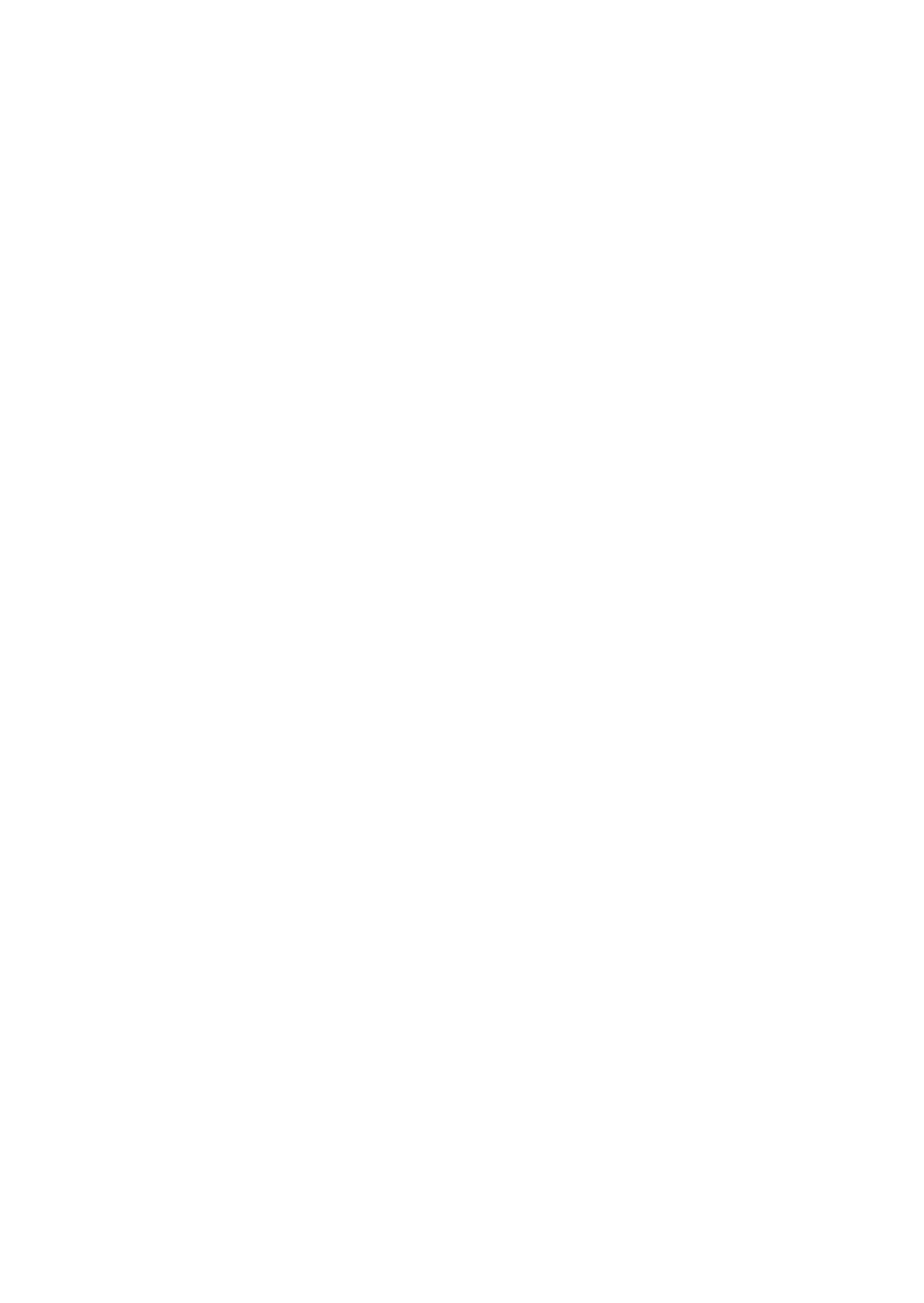
86
[78]
α.
Notwendige und nicht notwendige Erkenntnisse
Das theoretische Hauptwerk Kantens, die „Kritik der reinen Ver-
nunft“ (1781) beginnt mit der grundsätzlichen Unterscheidung „der
reinen und empirischen Erkenntnis“, das heißt notwendiger und
nichtnotwendiger Sätze
1
. Die sinnliche Erfahrung, erklärt Kant,
„sagt uns zwar, daß etwas so oder so beschaffen sei, aber nicht, daß
es nicht anders sein könne“
2
, wie zum Beispiel bei den mathema-
tischen Urteilen, deren Notwendigkeit uns einleuchtet. Aus dieser
Trennung des Notwendigen von dem bloß Tatsächlichen — die
auch schon Leibniz als „Tatsachen“ und „Vernunftwahrheit“ vor-
kommt
3
— folgert Kant, daß alles, was wir als Notwendiges, All-
gemeingültiges an Einsichten in unserem Wissen finden, nicht aus
dem sinnlichen Erfahrungsstoffe stammen könne; mithin (logisch)
vor der Erfahrung sei; mithin, wie Kant sagt, a p r i o r i.
β.
Das Apriori
Die Ausführung dieses Gedankenganges bei Kant läßt sich durch
folgende Hauptpunkte kennzeichnen. Da jede Erkenntnis ein Ur-
teil ist; daß es Urteile gibt, welche allgemein und notwendig gelten;
da ferner alle Urteile Verknüpfungen, das heißt S y n t h e s e n
von Begriffen sind; und da endlich das Allgemeine und Notwendige
Philosophie vor Kant ist es wichtig zu beachten: daß Kant die Bedeutung der
Ausdrücke umkehrte. In der Philosophie vor Kant bedeutete V e r s t a n d (in-
tellectus, υούς) das höhere Vermögen, das Vermögen der Prinzipien, der Ein-
gebung (Intuition), des unmittelbaren Wissens, daher des Verstehens, des Ein-
sehens, das einsichtige Wissen; V e r n u n f t (ratio,
διάνοια, ίπιοτήμη)
dagegen:
das niedere Vermögen, nämlich das verarbeitende schließende Denken, das ver-
mittelte (nicht unmittelbare) Wissen, das Reflektieren.
Bei Kant ist es umgekehrt: der V e r s t a n d ist ihm das Vermögen der Be-
griffsbildung und der Kategorien, das vermittelte Denken; die V e r n u n f t da-
gegen „das Vermögen der Prinzipien“, oder „Ideen“ (z. B. Seele, Gott; daß
dieses Vermögen zur Eingebung im Sinne einer Ideenschau wird, leugnet Kant).
Außerdem bedeutet aber bei Kant „Vernunft“ den Inbegriff aller drei Vermögen:
der theoretischen und praktischen Vernunft und der von ihm so genannten Urteils-
kraft, das heißt der zweckrichtenden und künstlerischen Vernunft. — Überdies
stellt Kant die Sinnlichkeit der V e r n u n f t im weiteren Sinne (nämlich ein-
schließlich des Verstandes) gegenüber. /
1
Immanuel Kant: Kritik der reinen Vernunft, nach der 1. und 2
.
Original-
ausgabe neu herausgegeben von Raymund Schmidt, Leipzig 1926, S. 1 (= Philo-
sophische Bibliothek, Bd 37 d).
2
Immanuel Kant: Kritik der reinen Vernunft, Leipzig 1926, S. 3.
3
Siehe oben S. 84.









