
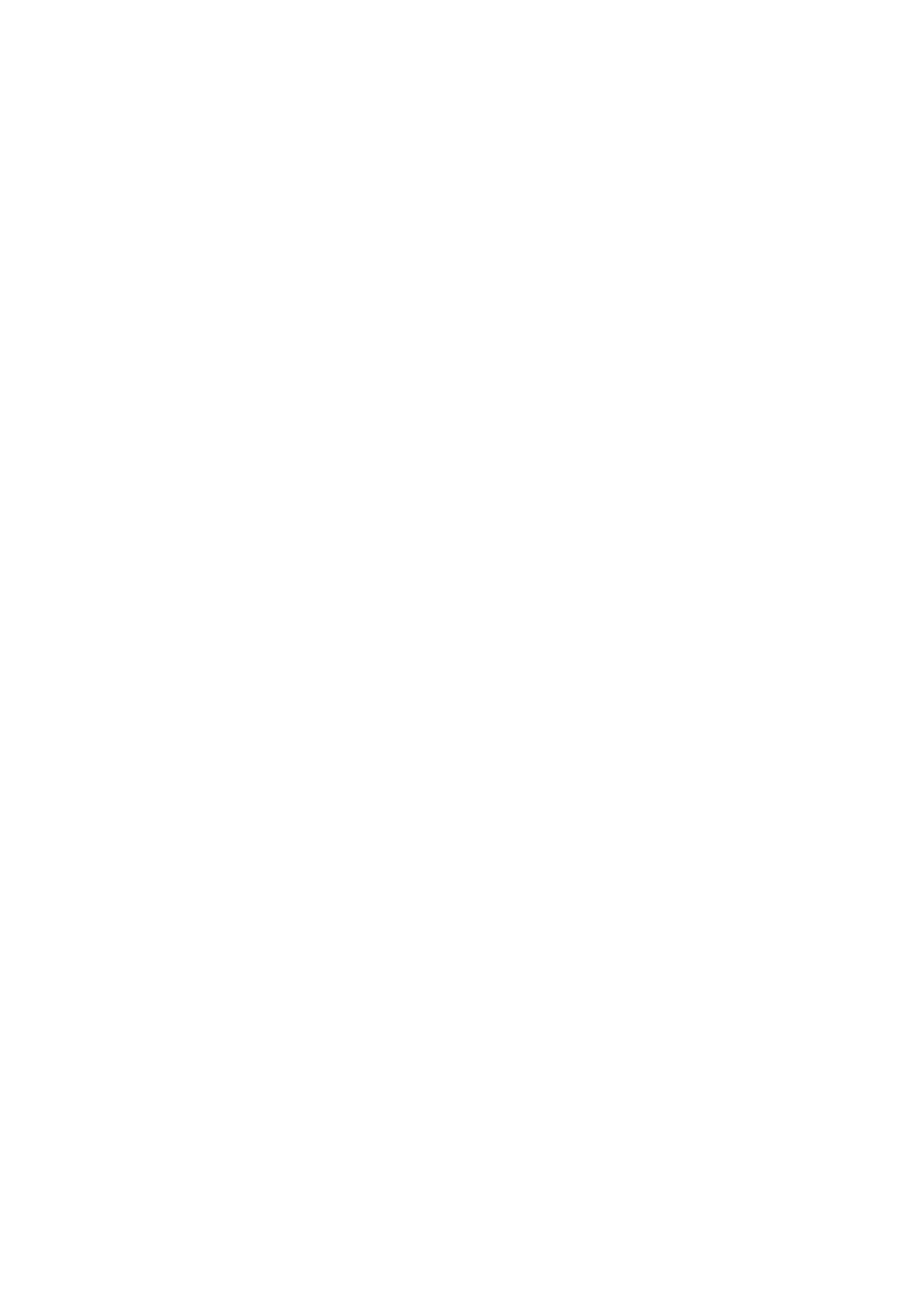
[294/295]
329
Verkehrt wäre es dagegen, den Unterschied zwischen griechischem und deut-
schem Idealismus in der „ S u b j e k t i v i t ä t “ zu erblicken, welche angeblich die
Griechen nicht gekannt haben sollen. Als ob je Menschen nicht gewußt hätten,
daß sie Menschen sind.
Z u s a t z ü b e r o b j e k t i v e u n d s u b j e k t i v e F a s s u n g d e s
I d e e n b e g r i f f e s , ü b e r s e i n e A l l g e m e i n h e i t u n d I n d i v i -
d u a l i t ä t s o w i e s e i n e p a n t h e i s t i s c h e n u n d n i c h t p a n t h e -
i s t i s c h e n F o l g e n
Wie sich zeigte, erweisen sich zwar die platonische Idee, die ari-
stotelische Form, die scholastische Substanz, die Leibnizische Mo-
nade, das Fichtische sich selbst setzende Ich, die dialektischen Set-
zungsstufen und sogar das Kantische Apriori in ihrem letzten
Grunde insoferne als ein und dasselbe, als sie den übersinnlichen
Grund in den Erscheinungen unserer Erfahrung (entweder an Din-
gen oder an Menschen) bilden; aber als ein wichtiger Unterschied
drängt sich die O b j e k t i v i t ä t o d e r S u b j e k t i v i t ä t
dieser übersinnlichen, das Sein begründenden Mächte auf. Die Pla-
tonische Idee, die Aristotelische Form, die scholastische Substanz,
die Leibnizische Monade, die dialektischen Setzungsschritte sind
o b j e k t i v , das Fichtische Ich und das Kantische Apriori ist sub-
jektiv, obzwar in beiden Fällen auch übersubjektive Momente gel-
tend zu machen sind (bei Fichte der mystische Grund der Iche, be-
sonders in der Spätlehre, bei Kant das rein Formale der Kategorien
einerseits, andererseits der Begriff der „Wissenschaft überhaupt“).
Aber sowohl bei den objektiven Fassungen wie bei den subjekti-
ven Fassungen tritt die Frage des G e s a m t z u s a m m e n h a n -
g e s a l l e r a l l g e m e i n e n G a t t u n g e n o d e r i n d i v i -
d u e l l e n F o r m e n auf und will in beiden Fällen gelöst sein.
Die Lösungsversuche sehen wir im P l a t o n i s c h e n B e g r i f f
d e r „ G e m e i n s c h a f t d e r I d e e n “
(
κοινωνία τών γενών
);
bei Aristoteles und den Scholastikern tritt diese Frage zurück; bei
Leibniz weist das Stichwort „ d i e M o n a d e n h a b e n k e i n e
L e n s t e r “ nachdrücklich auf die den individuellen Monaden
(gleich den Atomen der Naturwissenschaft) drohende Isolierung
hin. Nach Leibniz hängen sie aber in Gott zusammen (daher die
„prästabilierte Harmonie“ aller Wesen und insbesondere von Geist
und Körper); bei Fichte ist die Frage unter dem Namen „ S y n -
t h e s i s d e r G e i s t e r w e l t“, das heißt der menschlichen /
Iche, aufgeworfen. In der Dialektik soll sie durch den S t r u k t u r -









