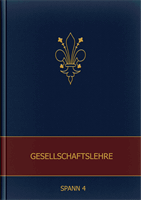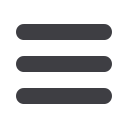[147/148]
183
l'imitation“)
1
, Erfindung eine glückliche Interferenz von Nachahmungsstrahlen
im Gehirn jener, die dem Milieu weniger angepaßt sind
2
.
M a r x e n s oft angeführter Ausspruch „Es ist nicht das Denken der Menschen,
das ihr Sein, sondern ihr gesellschaftliches Sein, das ihr Denken bestimmt“,
läßt das Denken als einen Ausfluß des „gesellschaftlichen Seins“ erscheinen (das
selber wieder aus der Wirtschaft als „Unterbau“, der Ideologie als „Überbau“
besteht), daher ja auch seine Geschichtsauffassung die „materialistische“ genannt
wurde
3
. — G u m p l o w i t z sagt: „Der größte Irrtum der individualistischen
Psychologie ist die Annahme: der
Mensch
denke. Aus diesem Irrtum ergibt sich
dann das ewige Suchen der Q u e l l e des Denkens im I n d i v i d u u m , und
der Ursachen, warum es so und nicht anders denke... Es ist das eine Kette von
I r r t ü m e r n . Denn erstens, was im Menschen denkt, das ist gar nicht er —
sondern seine soziale Gemeinschaft, die Quelle seines Denkens liegt gar nicht in
ihm, sondern in der sozialen Umwelt... und er k a n n n i c h t a n d e r s
d e n k e n als so, wie es aus den in seinem Hirn sich konzentrierenden Einflüs-
sen der ihn umgebenden sozialen Umwelt mit Notwendigkeit sich ergibt. In der
Mechanik und Optik kennen wir das Gesetz, wonach wir aus der Beschaffenheit
des Einfallswinkels diejenige des Ausfallswinkels berechnen. Auf geistigem Gebiete
existiert ein ähnliches Gesetz, nur können wir es nicht so genau beobachten.
Aber jedem Einfallswinkel eines geistigen Strahles in unser Inneres entspricht
genau ein gewisser Ausfallswinkel unserer Anschauung, unseres Gedankens, und
diese Anschauungen und Gedanken sind nur das notwendige Resultat der auf
uns seit unserer Kindheit eindringenden Einflüsse.“
4
— Ein Kommentar zu
solcher Tollheit, die den Geist als mechanischen Reflex faßt, dürfte überflüssig sein.
In der Umweltlehre wird „das Ganze“ als der Inbegriff der gesell-
schaftlichen Tatsachen gefaßt, die sich von außen in den Einzelnen
gleichsam hineinspiegeln und so diesem eigentlich nur ein Schein-
dasein einräumen. Wir sehen jetzt davon ab, daß diese Vorstellungs-
weise falsch ist. Maßgebend ist in unserem Zusammenhange, daß
durch / sie das gesellschaftliche „Ganze“ wieder bloß mechanisch
gefaßt, wieder materialisiert wird, wobei sie überdies die Selbstän-
digkeit des Einzelnen gänzlich vernichtet. Denn die Umwelt ist ihr
ein stofflicher oder geistiger „Komplex“, der als äußerer Gegenstand,
der mechanisch auf den Menschen wirken soll! Man kann diesen
Schein-Universalismus den „mechanischen Universalismus“ nennen.
Der Grundfehler der umweltlichen Auffassung liegt darin, daß sie
einen falschen, durchaus naiven Begriff der Umwelt zugrunde legt,
indem sie diese als toten Gegenstand faßt, der auf uns „wirkt“.
1
Siehe oben S. 48.
2
Gabriel Tarde: Die sozialen Gesetze, Skizze zu einer Soziologie, deutsch von
Hans Hammer, Leipzig 1908, S. 104 (= Philosophisch-soziologische Bücherei,
Bd 4).
3
Vgl. oben S. 47.
4
Ludwig Gumplowitz: Grundriß der Soziologie, 2. Auf!., Wien 1905, S. 268.