
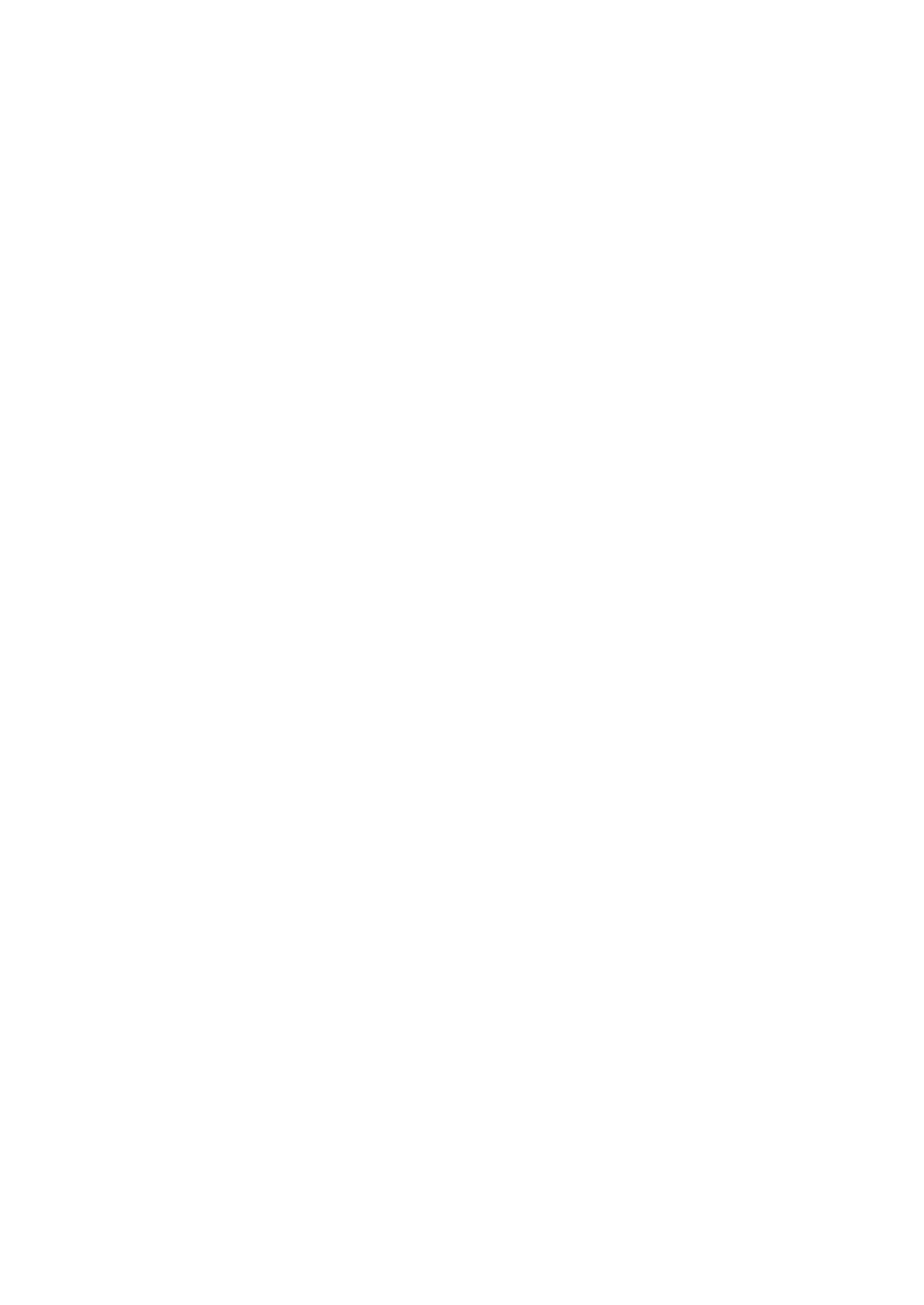
[176/177]
I
65
l i c h m a c h e n , indem sie ihm die Erreichung jener Ziele ermöglichen! Weil
das physiologische Ziel der Dringlichkeit nach vorgeht, geht es noch nicht
dem Range nach vor, macht seine Erreichung noch nicht glücklicher!
5.
Gegenseitigkeit von Stillung und Weckung des Bedürfnisses
Die meisten der vorgebrachten Einwände lassen sich auf eine
Erscheinung zurückführen, die dem Gossenschen Gesetz und dem
Grenzgedanken ganz allgemein widerspricht; darauf nämlich, daß
innerhalb gewisser Grenzen jeder Schritt der Sättigung die Neigung
hat: das B e d ü r f n i s g l e i c h z e i t i g z u s t i l l e n u n d d o c h
a u c h n e u z u w e c k e n . Hierfür ist der Säufer ein deutliches
Beispiel, aber auch in den angeführten Fällen der Arznei, des Spa-
zierengehens, des Geigenspielens, des Bücherlesens, des Schauspiel-
hörens, des Weinkennertums, des Einwerkeins der Maschine zeigt
sich dasselbe. Deutlich ferner bei alldem, was Ausschweifung (Exzeß)
im schlechten, aber auch im guten Sinne genannt wird, und gewiß
im Leben eine große Rolle spielt. G a n z e E r w e r b s z w e i g e :
S p i e l h ö h l e n , L o t t e r i e n , V e r g n ü g u n g s s t ä t t e n , b e -
r u h e n j a z u m g u t e n T e i l e d a r a u f . Auch für hohe geistige
Ziele gilt das Gleiche. Meister Eckehart sagt: „An geistigen Dingen
gibt es keine Sättigung, denn je mehr man davon hat, desto mehr
dürstet man danach.“
Wenn man demgegenüber darauf hinwiese, daß schon der Mathematiker
Bernoulli das Beispiel von dem einen Taler, der den armen Mann glücklich
mache, für den Millionär aber nichts bedeute, gebraucht habe, so beweist
man damit nichts. Denn hier handelt es sich um einen Millionär, dessen ge-
samtes Zielsystem im wesentlichen als erreicht gedacht wird; sonst könnte
ja auch für ihn 1 Taler, wenn er damit etwa den Protest eines Wechsels/zu
verhindern vermöchte, von größter Bedeutung werden. Daß 1 Taler wenig
bedeute, könnte man übrigens auch von einem innerlich armen Philister an-
nehmen, der, obzwar kein Millionär, dennoch mit seinem täglichen Lebens-
lauf (trotz aller Dürftigkeit) höchst zufrieden ist. Wie steht es ferner mit
einem armen, asketischen Klosterbruder, der mit dem Taler nichts anzu-
fangen wüßte; wie dagegen mit einem armen, aber leichtsinnigen Manne,
der 1000 Taler gewinnt und in einer Nacht vertut? — könnte im Vergleich zu
diesen beiden Fällen der Millionär nicht mehr mit dem Gelde anfangen, nicht
mehr davon gewinnen? Auch ist in diesem Beispiele die gleichmäßige
„Stückelung" der Einheiten (in beiden Fällen ein Taler!) falsch.
1
6.
Ungültigkeit des Gossenschen Gesetzes für Aufwendungen des
sogenannten Realkapitals
Hier zeigt sich grell das Gegenteil des Gossenschen Gesetzes. Be-
1
Vgl. auch unten S. 190 ff.









