
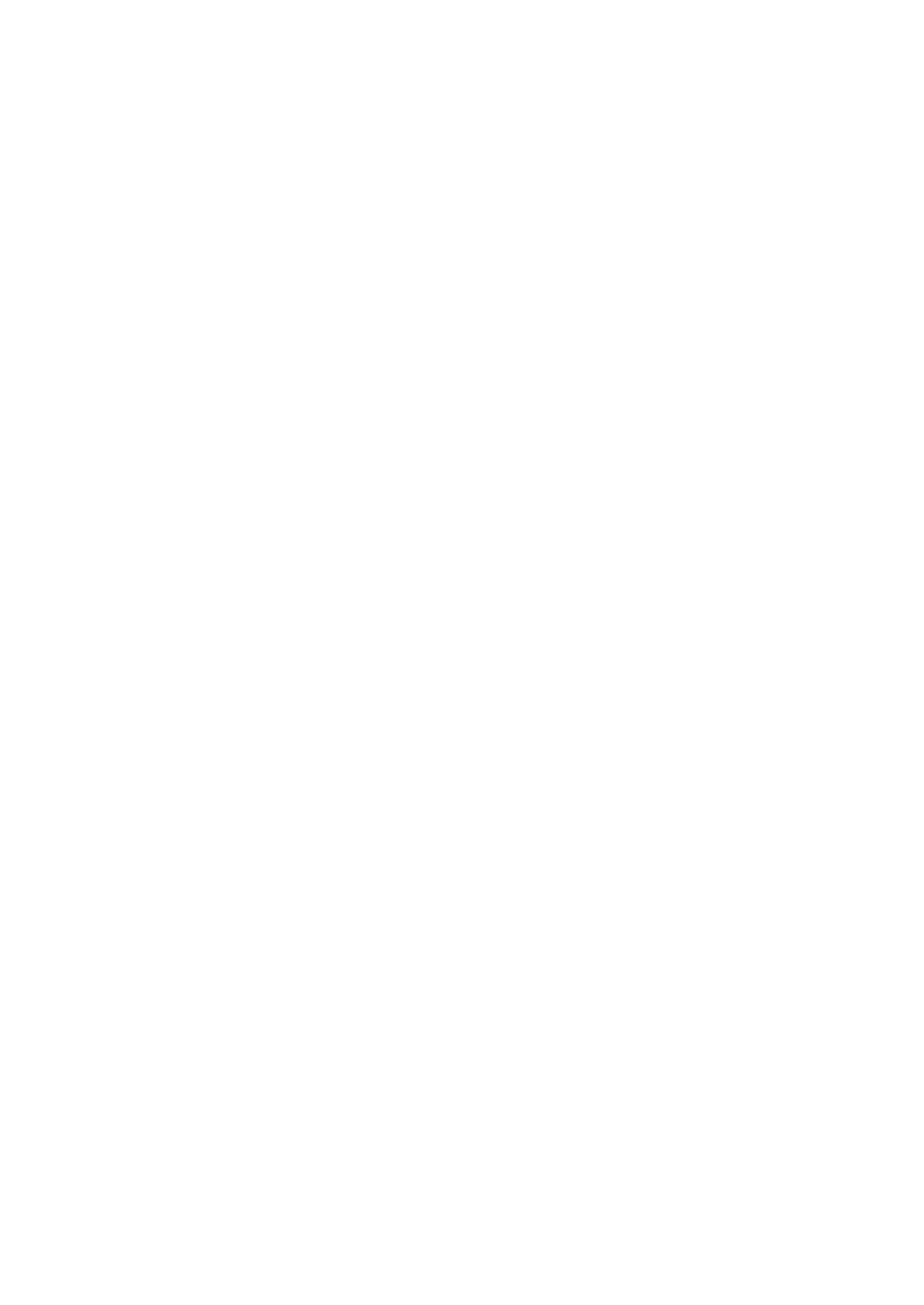
[448/449/450]
403
geleitet hätte. — Die betreffende Stelle lautet in der Verdeutschung von Rolfes
1
:
„Auf die genannten Systeme aber folgte die Spekulation P 1 a t o s, welche sich in
den meisten Stücken den letztgenannten Philosophen [den Pythagoräern] an-
schließt, jedoch auch im Vergleiche zu der Philosophie der italischen Denker man-
ches Eigentümliche hat. Da er nämlich in seiner ersten Periode schon ganz früh
mit K r a t y l u s und der Meinung H e r a k l i t s , daß alles Sinnliche bestän-
dig fließe und es keine Wissenschaft davon gebe, vertraut / worden war, so hielt
er diese Ansicht auch für die Folge fest. Da sich aber S o k r a t e s mit den sitt-
lichen Fragen befaßte und die ganze Natur beiseite ließ, hier aber in der Ethik
das Allgemeine suchte und als erster sein Augenmerk auf Begriffsbestimmungen
richtete, so zollte er ihm Beifall und meinte auf Grund jener Ansicht, das De-
finieren habe anderes zum Gegenstande, nichts Sinnliches; denn eine allgemein
gültige Bestimmung irgendeines sinnfälligen Dinges sei unmöglich, da diese sich
ja beständig änderten. Er gab nun jener Art des Seienden [das er voraussetzte,
auf das er nicht zu schließen brauchte; eigene Anmerkung] den Namen Idee...“
Aristoteles sagt nicht, er erfand die Ideen, er sagt nur, daß er ihnen den Namen
gab und nennt im Gegenteile P y t h a g o r a s als den Vorgänger! — Auch sonst
hebt Aristoteles das Ontologische stets hervor, zum Beispiel heißt es bald darauf:
„Da aber nach ihm die Ideen Ursachen für die andern Dinge sind, so glaubte er,
daß ihre Elemente Elemente alles Seienden wären.“
Das Ontologische steht als selbstverständlich voran. Auch hat Aristoteles gerade
an dieser Stelle den Vorrang der Pythagoräer in der Ideenlehre ausgesprochen,
indem er sagte: „Die P y t h a g o r ä e r lassen die Dinge durch Nachahmung
der Zahlen existieren, P l a t o aber durch Teilnahme, was nur ein anderes Wort
ist. Was aber diese Teilnahme an den Ideen oder diese Nachahmung eigentlich
ist, das haben sie andern zu untersuchen überlassen.“ Und vorher: „Mit dem
Ausdrucke Teilnahme war aber nur ein neues Wort [durch Platon] aufge-
bracht.“
Aus all dem folgt: daß die platonischen Ideen ihrem Ursprunge
nach nicht Allgemeinbegriffe, sondern ontologische Wesenheiten
sind. Unter anderen Eigenschaften haben sie allerdings auch diese,
die Erkennbarkeit der Dinge trotz ihrer Veränderungen zu be-
gründen.
Zur A n n a h m e v o n I d e e n k o n n t e k e i n a n d e -
r e s D e n k e n k o m m e n a l s d a s r e l i g i ö s - m e t a -
p h y s i s c h e . Die erkenntnistheoretischen Krücken hätten nie-
mals dahin geführt. Wer das Wesen der Idee einmal begriffen hat,
sieht ein, daß j e d e metaphysische Auffassung des Seins, indem sie
das Sinnliche in einem Übersinnlichen verankert sieht, notwendig
zur Annahme der „Idee“ führt — denn diese ist nichts anderes als
die übersinnliche Schaffenskraft, die über oder in den Dingen wal-
tet. Darum ist zu wiederholen, was oben schon ausgesprochen /
wurde, daß in jedem religiösen Denken, ganz besonders aber im
* S.
1
Aristoteles: Metaphysik, übersetzt von Eugen Rolfes, 2. Aufl., Leipzig 1920,
S. 17 (= Philosophische Bibliothek, Bd 2 b—3 b).









