
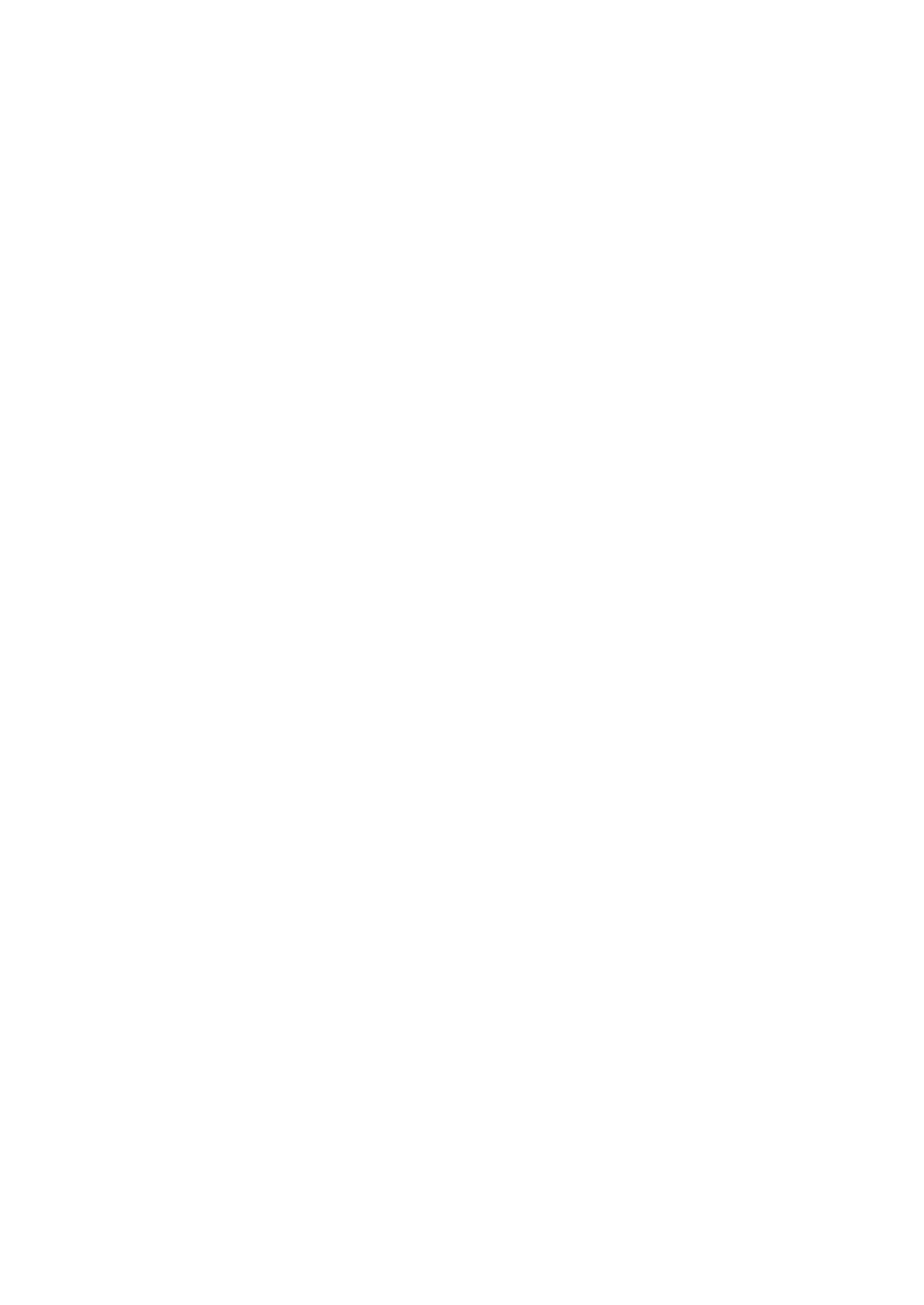
[13/14]
23
Jahrbuch, Band LII).; von S e c k e n d o r f f („Teutscher Fürstenstaat“,
1656), der unter den deutschen Merkantilisten besonders bedeutende
J o a c h i m B e c h e r („Politischer Diskurs von den eigentlichen Ur-
sachen des Auf- und Abnehmens der Städte, Länder und Republiken“,
1668); W. v. H o r n i g k („Österreich über alles, wenn es nur will“, 1684,
wurde von Oncken fälschlich für ein nachgelassenes Werk Bechers gehal-
ten) ; W i l h . v . S c h r ö d e r („Fürstliche Schatz- und Rentkammer“, 1686);
von J u s t i („Staatswirtschaft“, 1755) und J. v. S o n n e n f e l s („Grund-
sätze der Polizei, Handlung und Finanzwissenschaft“, Wien 1763—1767).
— Vgl. Zielenziger, Die alten deutschen Kameralisten, 1914. W. Heinrich,
Wirtschaftspolitik, I, 2. Auflage, Berlin 1964, Seite 4 ff. und Seite 17.
C.
Beurteilung der merkantilistischen Lehren, zugleich Einführung
in die heutige Lehre vom Geld und von der Handelsbilanz
Das Urteil der heutigen Volkswirtschaftslehre über den Mer-
kantilismus ist geteilt. Jene Richtungen, die auf dem Standpunkte
der Nichteinmischung des Staates in die Wirtschaft stehen (die
individualistischen, freihändlerischen), lehnen den Merkantilismus
ab; die geschichtliche Schule dagegen, die den Grundsatz der staat-
lichen Förderung der Volkswirtschaft vertritt, billigt dem Mer-
kantilismus wenigstens eine bedingte geschichtliche Berechtigung
zu; die universalistische Richtung beurteilt die merkantilistische
Auffassung günstig und erkennt an, daß man auch heute wieder
zur Förderung der Volkswirtschaft ähnliche Maßnahmen ergreifen
müsse wie sie.
/
Der Leitbegriff der merkantilistischen Lehren ist die günstige
Handelsbilanz. Da diese aber in erster Linie auf der Bedeutung
der Geldeinfuhr gegründet ist, besprechen wir zuerst die Geldlehre.
1.
D a s G e l d
Die Merkantilisten haben zwar nicht, wie man ihnen vorwarf
(Oncken ist dem zuerst kräftig entgegengetreten), das Geld gerade-
zu mit Reichtum gleichgesetzt; aber sie haben allerdings die volks-
wirtschaftliche Bedeutung des Geldes und der Edelmetalle über-
mäßig hoch eingeschätzt, in ihm zum Teil das „Gut der Güter“
gesehen, was in einer Zeit des Aufkommens der Geld- und Kapital-
wirtschaft nicht wundernehmen kann.
Eine verwandte, wenngleich verwässerte Überschätzung des
Geldes entspricht noch heute der gewöhnlichen Meinung. „Wer
Geld bekommt, wird reich, also handelt es sich auch in der ganzen









