
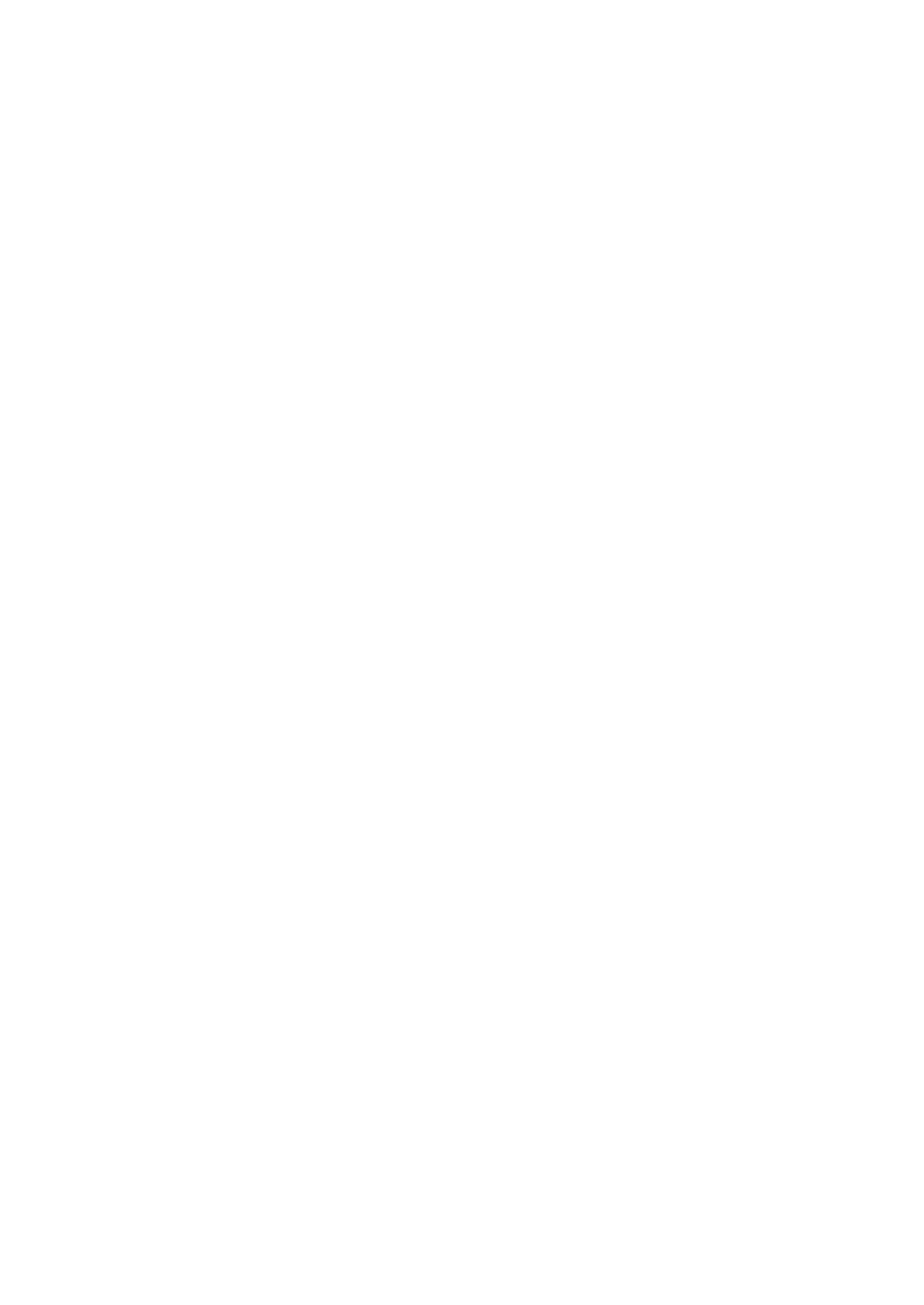
80
[66/67]
wirtschaftliche Handeln wird dann als seiner Natur nach rein vom
„Eigennutze“ des Einzelnen abhängig gemacht. Daher der „homo
oeconomicus“ oder Robinson (das heißt die Frage: Wie würde ein
Wirtschaftssubjekt ceteris paribus handeln?) die ständige Hilfs-
unterstellung dieses Verfahrens ist. Daß Irrtum, Unwirtschaftlichkeit
und so fort die reine Wirtschaft stören, wird dabei zugegeben, aber
ausgeschaltet, um eine „reine Theorie“ zu erhalten.
Diese Lehre ist unseres Erachtens abzulehnen. Die Losreißung
der Wirtschaft aus dem unteilbaren Ganzen der Gesellschaft ist
wesenswidrig und ebenso die Postulierung eines Grundtriebes, des
„Eigennutzes“, den es als a l l e i n wirksamen nicht gibt und der
auch insofern nicht rein subjektiv ist, als im Gesamtganzen der
Wirtschaft immer objektive Voraussetzungen hat. Wirtschaft ist
nämlich nur innerhalb des Systems der Ziele möglich, daher die
Mittel — auch die aus Eigennutz entspringenden Handlungen der
Einzelnen — das Reich der Ziele, die ganze Kultur, w i d e r s p i e -
g e l n . Kulturabgelöste, „abstrakte“ Wirtschaft gibt es nicht. —
Daher ist auch die Lehre vom Zusammentreffen der individuellen
Eigennutze auf dem Markte unrichtig. Stets sind es schon v o r -
g e g e b e n e Gebilde, z. B. Betriebe, Marktzusammenhänge, in die
sich der Einzelne e i n z u g l i e d e r n hat. Die Sacherfordernisse
dieser Gebilde, nicht allein die subjektiven Eigennutze der Einzel-
nen sind aber für die Eingliederung maßgebend: Der o b j e k t i v e
E i n g l i e d e r u n g s g r u n d t r i t t a n d i e S t e l l e d e s s u b -
j e k t i v e n E i g e n n u t z e s
1
. Auch aus diesem Grunde, der sinn-
vollen Ein- und Umgliederung, ist der Preis keine mechanisch-
mathematische Resultante. Daher standen die Merkantilisten, die
ihn staatlich, die Scholastiker, die ihn sittlich-religiös auffaßten,
höher als Smith.
Die abstrakte Auffassung läßt allerdings dem deduktiven Verfahren
einen besonders weiten Spielraum, indem bei der Annahme der Wirk-
samkeit des „Eigennutzes“ als des einzigen Motivs alle Vorgänge bei /
der Wertbildung, Erzeugung, Verteilung und dem Verbrauch streng ge-
setzmäßige, im voraus a b l e i t b a r e sein müssen. Es ist aber klar, daß
ohne fortwährende „Induktion“ auch diese Forschungsweise nicht aus-
kommt, weshalb es ungenau ist, wie heute üblich, schlechthin von einer
„deduktiven Richtung“ bei den Klassikern zu sprechen; vielmehr ist deren
a b s t r a k t e A u f f a s s u n g der Wirtschaft, welche diese von allen
1
Siehe unten S. 114 f.









