
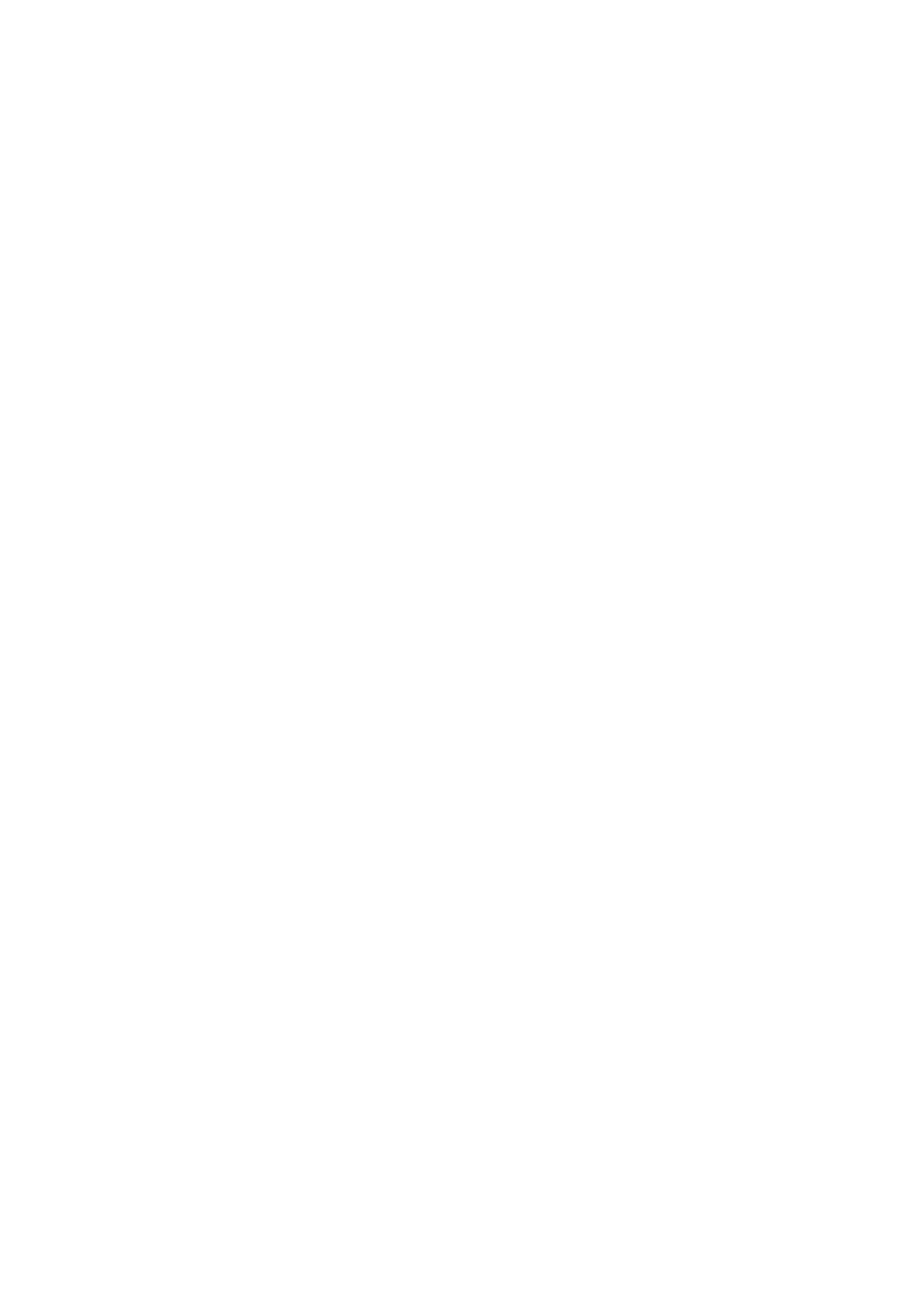
[128/129]
143
weist uns unter anderem die Hervorhebung der „Selbstmächtigkeit“
(
έγκράτεια
)
in seiner Tugendlehre
1
.
Das Neue, das Fichte brachte, besteht also nicht eigentlich in dem Gedanken
der Selbstsetzung. Es besteht darin, daß er diesen Gedanken zur Mitte des Be-
griffsgebäudes machte, obgleich Ansätze dazu bei den Mystikern, bei Leibniz und
anderen nicht fehlen; dies war aber nur dadurch möglich, daß er zum Unter-
schiede von früheren Lehren, die es bei der Selbstbewegung bewenden ließen, den
zweiten Satz hinzufügte, wonach die Selbst-Setzung zugleich Selbst-Entgegen-
setzung sei, das Bewußtsein daher Subjekt-Objekt.
/
E. B e u r t e i l u n g F i c h t e s
„Ich aber, frei wie mir’s im Herzen spricht,
Verfolge froh mein innerliches Licht.“
Goethe auf Fichte, „Faust“, II.
Fichte wird heute zwar als Charakter geehrt, aber als Philosoph
nicht verstanden. Es ist ein billiger Spott, Fichtes „Ich“ als eine
Widersinnigkeit zu erklären, sich darüber zu entrüsten, daß die
Welt nur eine Setzung, gleichsam nur ein Traum des Ich sein solle
(Solipsismus). Man muß sich, um hier wie in ähnlichen Fällen in
der Geschichte der Philosophie über den Anschein allzu handgreif-
licher Unrichtigkeit hinwegzukommen, zweierlei fragen: Erstens,
w e l c h e r S y s t e m g e d a n k e z w a n g d e n P h i l o s o -
p h e n , an die Fragestellungen und Absichten seiner Zeit anzu-
knüpfen? Diese Frage ist sehr wichtig. Denn wie stellt man sich
denn das Philosophieren vor? Etwa als eine einsame Beschäftigung?
Da würde man sehr irren. Der Philosoph berührt, was das Innerste
der Zeit bewegt. Er muß sich an diese seine Zeit wenden und kann
seine Gedanken nicht so entwickeln, wie es ihm am besten scheint,
sondern so wie er verstanden wird. Beurteilt man Fichte von die-
sem Standpunkte aus, dann versteht man, daß er mit seinem Aus-
gangspunkte vom „Ich“ und seiner „Selbstsetzung“ dasjenige be-
griff, wozu damals alle Denkaufgaben der die Zeit beherrschenden
Kantischen Lehre hindrängten.
Zweitens: Welche innere Stellungnahme, welche geheime Schau
der Welt, liegt unter der Hülle des äußeren Systemaufbaues und
1
Xenophon: Memorabilien, griechisch und deutsch, Leipzig 1863, IV, 5, §§ 6,
11 und öfter (= Werke, Bd 4).









