
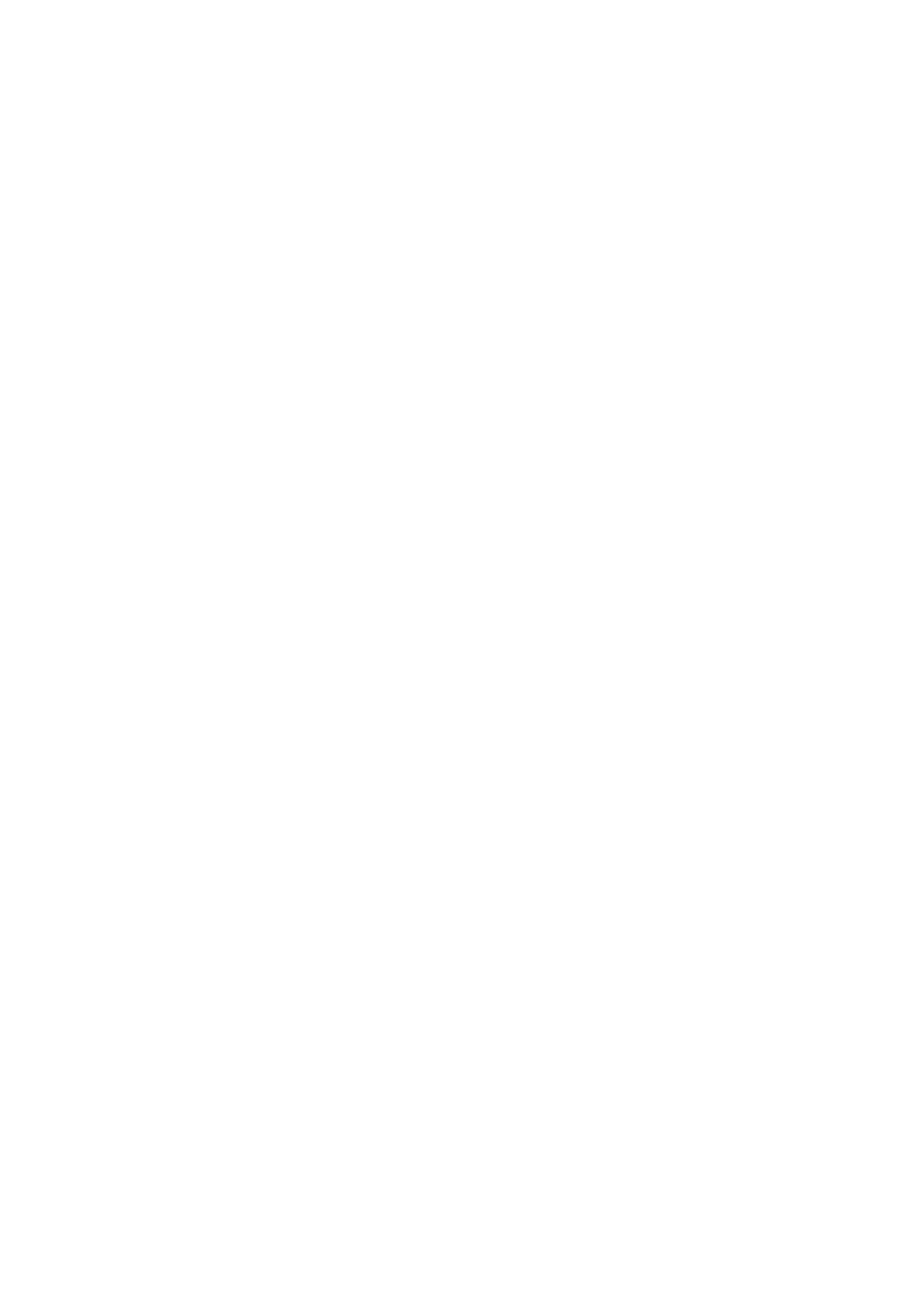
[212/213]
237
ter die gebundene Stellung des Einzelnen im Staate zu verstehen, muß man nur
wissen, daß die Anteilnahme an einer Verrichtung (einem Stande) die einzige
Möglichkeit ist, das seelische Eigenleben des Einzelnen zur Entfaltung zu bringen
1
.
Allen diesen und ähnlichen Einwänden ist Platons Staatslehre durchaus ge-
wachsen. Ihre Größe liegt in der Führerlehre. Der Führer ist der Seher. Er gibt
das in der Ideenschau Erkannte an die Lebensgemeinschaft als gestaltenden Ge-
danken weiter. Die Scheidung der Verrichtungen, das Ständetum, ist die not-
wendige Folge. Die beste Erneuerung des Führertums, die Verhinderung seiner
Erstarrung, betrachtete Platon als die wichtigste Aufgabe der Staatsgestaltung.
Ihr opfert er sogar, wie betont, die Familie im Kreise jener auserwählten Führer
2
.
Über Platons A u f s t i e g l e h r e siehe unten Seite 369 f., S i t t e n l e h r e
siehe unten Seite 370 f.
B. A r i s t o t e l e s (384 bis 322 v. Chr.)
Nur äußerlich gesehen, erscheint das Lehrgebäude des Aristoteles
im Vergleiche zu jenem Platons als ein anderes. Im innersten Kerne
ist es das gleiche, trotz aller Um- und Fortbildung der meisten Lehr-
begriffe. Man darf sagen: So gut wie alle Hauptgedanken des Aristo-
teles erweisen sich als platonischen Ursprungs. Steht es doch ähnlich
im Verhältnisse Hegels zu Schelling sowie Schellings zu Fichte. Der
Kenner Fichtes findet in Schellings „System des transzendentalen
Idealismus“ überall Fichte wieder, der Kenner Schellings in Hegels
Begriffsgebäude Schelling, freilich beide Male in solchen Um- und
Fortbildungen, die wieder zu neuen Begriffszusammenhängen,
Denkaufgaben und Namengebungen führten.
/
Wie das Lehrgebäude des Aristoteles aufgebaut war und sich entwickelte,
können wir bei dem zerrütteten Zustande der meisten seiner Schriften, besonders
seines von ihm selbst nicht mehr herausgegebenen Hauptwerkes, der sogenannten
„Metaphysik“ (das heißt „nach der Physik“), nicht wissen. Zwar macht P a u l
G o h l k e
3
glaubhaft, daß es sich nicht um Vorlesungsnachschriften verschie-
dener Schüler, noch um fremde Einschübe oder ähnliche Gebrechen der Texte
handle, ferner — was besonders wichtig ist — daß a l l e s e c h t und von Aristo-
teles’ eigener Hand sei; dem wird wohl beizupflichten sein. Aber die Versuche,
eine „Urmetaphysik“ (Werner Jaeger) und eine „Urpolitik“ (von Arnim) aus dem
Überlieferten herauszuschälen, sind philosophisch nicht stichhaltig. Auch Gohlke,
1
Vgl. Walter Becher: Platon und Fichte, Die königliche Erziehungskunst,
Jena 1937.
2
Aus dem Schrifttum heben wir noch hervor: Alfred Verdroß-Droßberg:
Grundlinien der antiken Rechts- und Staatsphilosophie,
2.
Aufl., Wien 1948.
3
Paul Gohlke: Die Entstehung der aristotelischen Lehrschriften, Berlin 1933
(als Manuskript gedruckt); Aristoteles: Die Lehrschriften, griechisch und deutsch,
herausgegeben von Paul Gohlke, Paderborn 1948 ff. — Vgl. meine Besprechung in:
Anzeiger für die Altertumswissenschaft, Bd 1, Heft 3, Wien 1949.









