
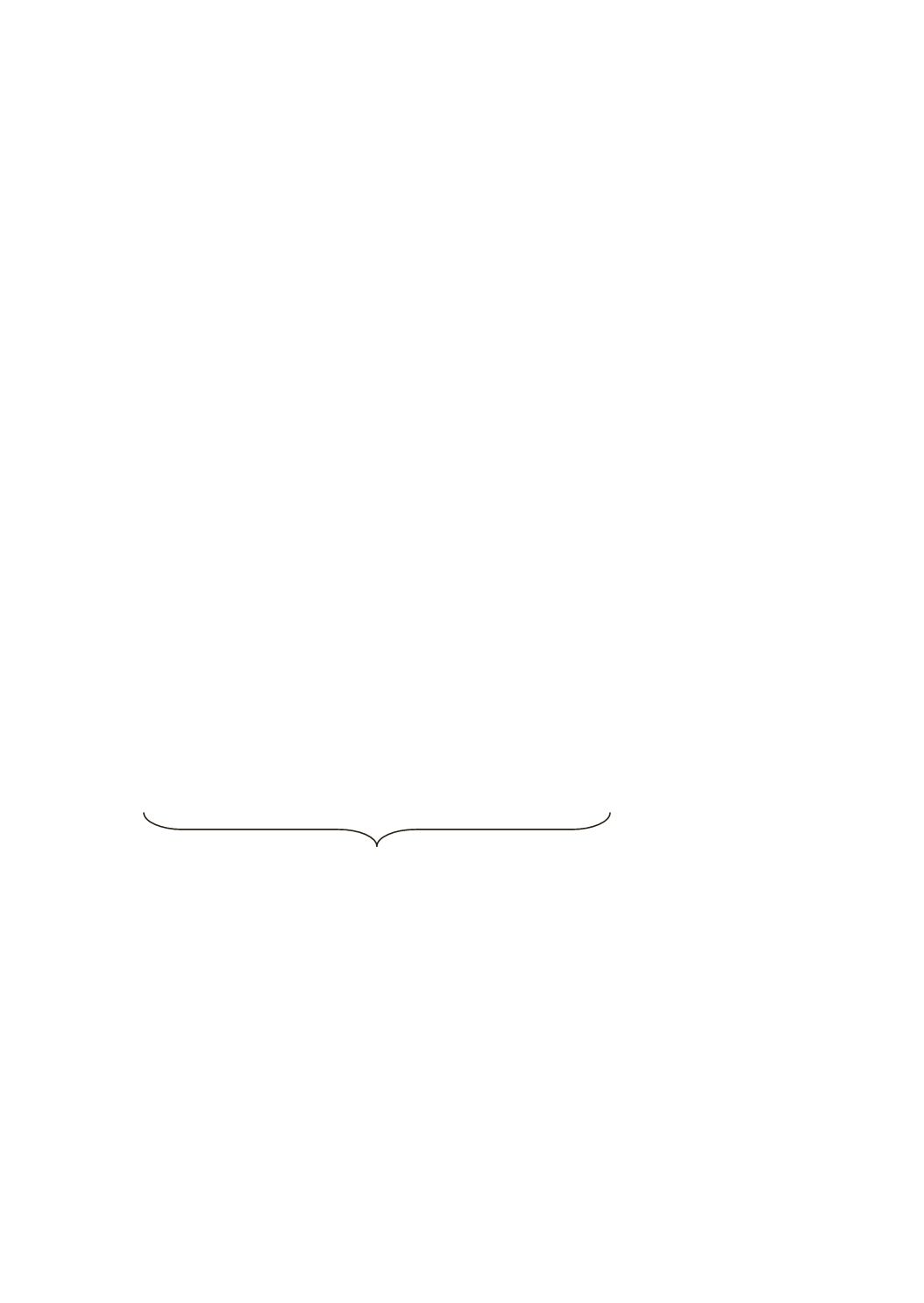
[240/241]
269
bei Fichte nicht durchgeführt, das heißt den Individualismus im Be-
griffsgebäude noch nicht überwunden. Erst später in den „Vorlesun-
gen über die Methode des akademischen Studiums“ (1803) erklärt
Schelling den Staat für einen sittlichen Organismus und begründet
ferner zum ersten Male einen ganzheitlichen Begriff der Ge-
s c h i c h t e .
δ.
Kunstphilosophie
Daß im Ich selbst Objektivität enthalten sei, war ein entschei-
dender Gedanke auch für die Kunstphilosophie Schellings. Die
Frage, wie die Subjektivität zur Natur komme, beantwortet Schel-
ling im „System des transzendentalen Idealismus“ durch den Hin-
weis auf jene zugleich bewußte und unbewußte Tätigkeit, welche /
wir im Kunstschaffen vor uns haben. Die „intellektuelle An-
schauung“ (Eingebung) der Erkenntnis wird in der Kunst zur
„ästhetischen Anschauung“. In ihr, die nur Auserwählten zukommt,
ist das Bewußtlose im Handeln und Hervorbringen einerlei mit
dem Gewußten oder Hervorgebrachten. Im Schönen stellt der Geist
die Idee dar. Das Schöne ist der Widerschein des Unendlichen im
Endlichen. So wird die Kunst metaphysisch begründet
1
.
ε.
Identitätsphilosophie
2
Die Identitätsphilosophie ging unmittelbar aus der Naturphilo-
sophie hervor (sollte ihr aber begrifflich vorangehen). Denn in der
Natur erscheint das Absolute als überwiegende Objektivität (Reali-
tät), im menschlichen Geist als überwiegende Subjektivität (Ideali-
tät), was sich durch das folgende Bild darstellen läßt:
+ -
±
wobei + die Setzung des Ich, die Subjektivität bedeutet; das
— dagegen die Entgegensetzung, die Objektivität; ± endlich das
sich erst setzende Ich, dasjenige, welches noch die „ I d e n t i t ä t “
1
Schelling: Sämtliche Werke, Abt 1, Bd 3, Stuttgart 1856, S. 612 ff. — Über
G e s c h i c h t s p h i l o s o p h i e siehe unten S. 271 f., 276 und 279 f.
2
Schelling: Bruno, oder über das göttliche und natürliche Prinzip der Dinge
(1802); Vorlesungen über die Methode des akademischen Studiums (1803), beide
in Schellings Sämtlichen Werken, Abt. 1, Bd 5, Stuttgart 1859.









