
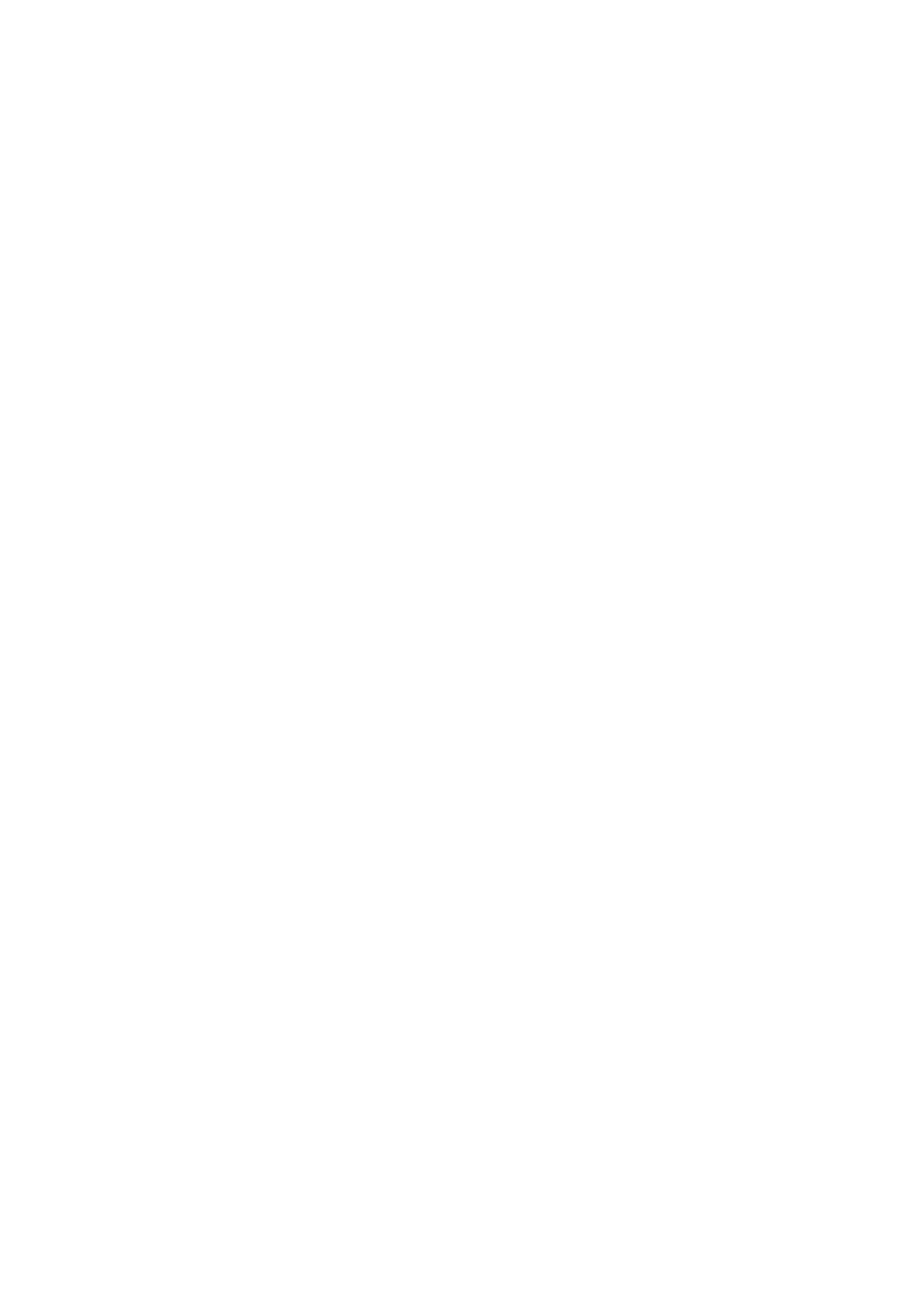
[246/247]
275
lichung Gottes wäre; sondern daß Gott für sich selbst schon eine Einheit in Man-
nigfaltigkeit, also Persönlichkeit, absolute Persönlichkeit bilde (in der „Freiheits-
lehre“, 1809).
β.
Identitätsphilosophie
Als Vermittlungslehre zwischen Überwelt und Welt genommen
war hingegen die Identitätsphilosophie ein eindeutiger Fortschritt.
Ihr geschichtlicher Wert liegt unseres Erachtens darin, daß sie die
Wendung in das Gegenständliche, ins Ontologische erst ganz voll-
zog, was bei dem damaligen Subjektivismus der europäischen Philo-
sophie als ein Weltereignis bezeichnet werden muß. Als Teil der
Ontologie gesehen, hat ferner die Identitätslehre unbestreitbar rich-
tige Gedanken ausgesprochen, Gedanken, die auch heute noch und
immer in der Philosophie gelten. Denn daß Natur und Geist, da sie
doch verbunden sind, auf irgendeinem Punkte ihrer Wesenswurzel
verwandt sein müssen, ist eine Forderung des Denkens, die nicht
umgangen werden kann. Die Tatsache, daß der Mensch sich in der
Natur finde und daß das Höchste des Menschen, sein Geist, diese
Natur erkenne, fordert einen gemeinsamen Punkt, auf dem sie sich
treffen können, — also irgendeine Einerleiheit, Identität. Die Be-
stimmung der „Identität“ wird erst dann unrichtig, wenn sie sich
nicht auf die Geschaffenheit beider Seinsbereiche beschränkt, son-
dern auf das höchste Sein, die Gottheit, übertragen wird, vor allem
aber dieses damit erschöpfen will.
Infolge der Vermischung des im engeren Sinne Ontologischen und
des Theologischen wurden bei Schelling leider auch die richtigen Be-
stimmungen der Identitätslehre verhältnismäßig unfruchtbar. In
immer neuen Anläufen versucht daher Schelling neue Wendungen
derselben. Endlich verläßt er diesen Standpunkt (richtigerweise
nicht vollständig, sondern nur als das Absolute nicht erschöpfend),
indem er in der Schrift „Philosophie und Religion“ (1804) das
Hervorgehen der endlichen Dinge aus dem Unendlichen nicht mehr
durch stetige Übergänge, sondern durch einen Bruch (Abfall) er-
klärt und das Irrationale / des Seins gegen das Rationale des Be-
griffs eindringlich hervorhebt
1
.
Dagegen blieb Schelling der in der Identitätsphilosophie enthaltenen D i a l e k -
t i k auch später treu. Allerdings gibt er ihr in seinen letzten Werken eine andere
1
Siehe oben S. 271 f.









