
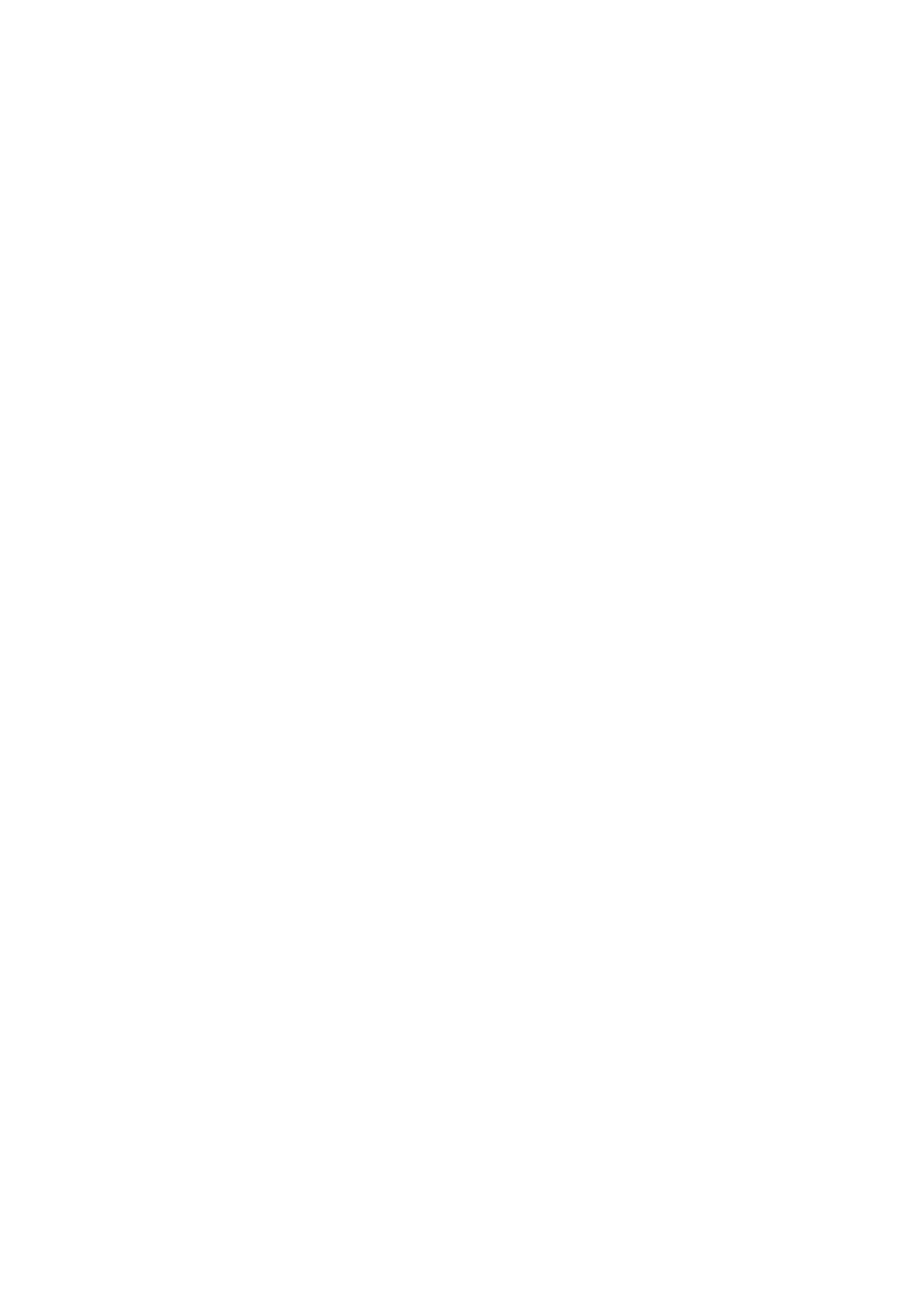
[278/279]
313
liche und es besteht keine materielle Außenwelt. — Andererseits nimmt Berkeley
nichts an als Gott und die endlichen Geister, in denen ein überlegener Geist, Gott,
die Empfindung der körperlichen Dinge bewirke. Hiermit ist ein spiritualistischer
Idealismus ausgesprochen, der bei aller Subjektivität der Empfindungen ein Ob-
jektives, Gott, setzt.
Berkeley will also empiristischen Subjektivismus und spiritualistischen Idealismus
miteinander verbinden, kommt aber dabei über eine widerspruchsvolle Mischung
nicht hinaus.
D .
F r i e d r i c h H e i n r i c h J a c o b i (1743—1819), F r i e d -
r i c h D a n i e l S c h l e i e r m a c h e r (1768—1843)
Wir gehen hier auf J a c o b i nur ein, soferne er in seiner Glaubensphilosophie
eine grundsätzliche Trennung von Glauben und Wissen begründen will, deren
Vereinigung doch stets die wichtigste Aufgabe der Philosophie war. Er hebt rich-
tig die U n m i t t e l b a r k e i t des Glaubens hervor: Glaube ist ihm ein Grund-
akt, der allem Erkennen vorgeht. Damit erhebt er sich geradezu ins Mystische.
Indem ihm aber der Glaube im Gegensatze zur Vernunft steht, sein Gegenstand,
Gott, ihm daher unerkennbar ist, wird er zum Skeptiker. Denn Glaube wird ihm
damit zum bloßen Gefühl. Das Gefühl aber lasse sich, sagt Jacobi, nicht beweisen;
und das bedeute die Trennung von Glauben und Wissen. — Der Fehler hegt darin,
die innere metaphysische Erfahrung als bloßes, in den Gedanken nicht zu erhe-
bendes „Gefühl“ (heute würde man sagen „psychologistisch“) zu behandeln; was
zur Verzweiflung an wirklicher Wissenschaft führt. Überdies lehrt Jacobi eine
mechanistische Naturauffassung. Empiristische und metaphysische Elemente wer-
den dadurch dilettantisch vermischt.
Bedeutender ist die Lehre F r i e d r i c h D a n i e l S c h l e i e r m a c h e r s .
Sie hat das Verdienst, den Glauben als ein ursprüngliches, unmittelbares, nicht ein
abgeleitetes Element des menschlichen Geistes zu fassen; doch sie erklärt den
Glauben aus dem „Gefühl“ der menschlichen „Abhängigkeit schlechthin“. Dem-
nach könne das Absolute nicht Gegenstand des Wissens sein. Die notwendige
Folgerung, daß dann die Philosophie abdanken müsse, zog jedoch Schleiermacher
im Gegensatze zu Jacobi nicht. — Hiemit ist allerdings Schleiermacher, der
Schellingen nahe stand, in Lehre und Bedeutung nicht erschöpft. Seine Verdienste
liegen namentlich auf dem Gebiete der Theologie und Sittenlehre, wo er mit Recht
großen Einfluß erlangte
1
.
E .
A r t h u r S c h o p e n h a u e r , F r i e d r i c h N i e t z s c h e
In gewissem Sinne waren schon in Fichtes Setzungslehre, noch mehr aber in
Schellings Identitäts- und Freiheitsphilosophie zwei Systeme angelegt: ein logi-
sches, wonach das Absolute als Vernunft zu bestimmen und die Welt darnach zu
1
Uber J a k o b F r i e d r i c h F r i e s u n d J o h a n n F r i e d r i c h
H e r b a r t siehe oben S. 96 f.









