
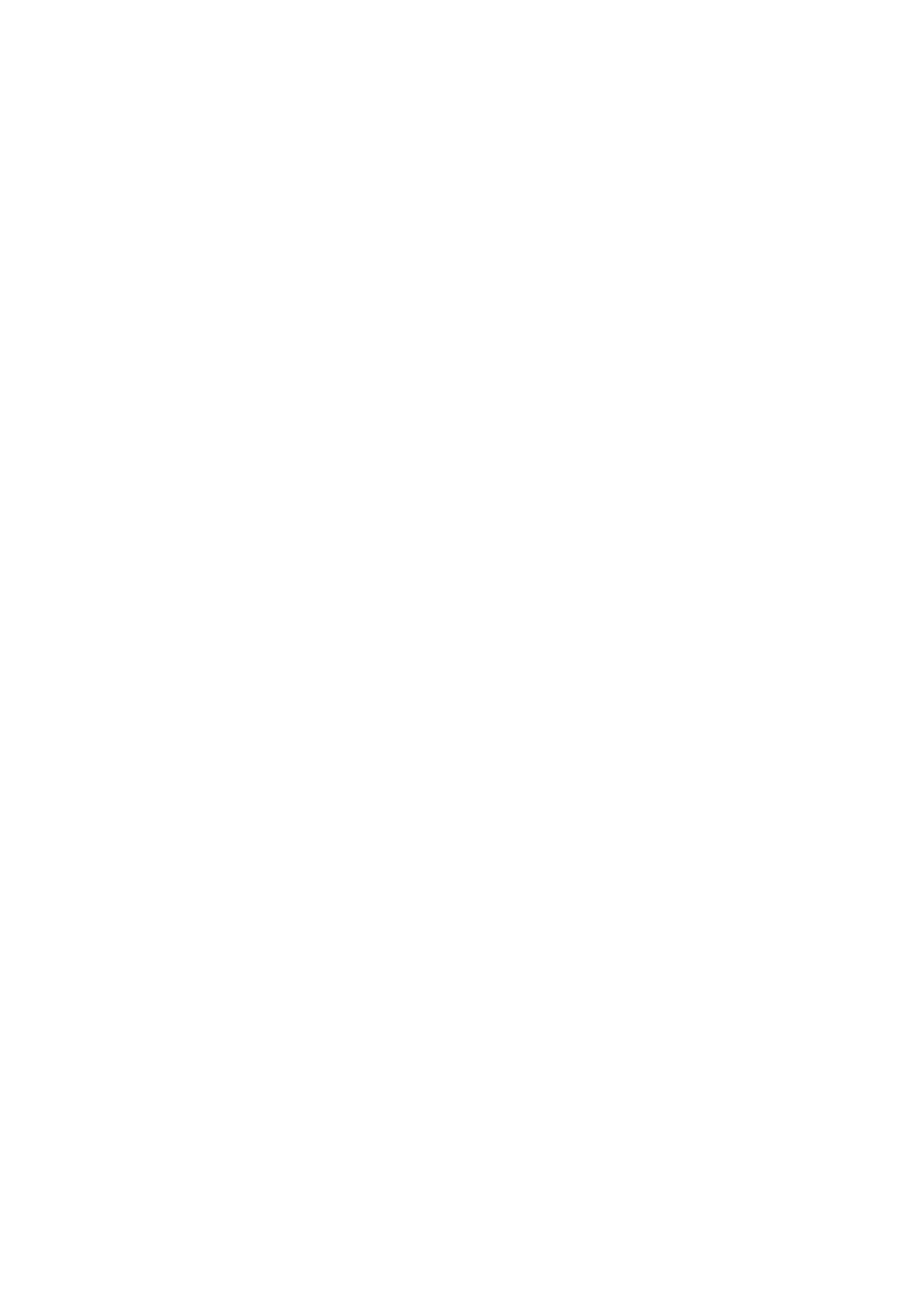
[117/118]
137
(mittels Gartenwirtschaft), Milch (durch intensiven Futterbau und
Stallfütterung in Abmelkereien), Verkauf von Heu und Stroh,
der Kornbau ist dabei Nebensache; ferner Güter, die durch Be-
förderung aus weiter Ferne zu teuer werden: Kartoffeln, Kohl,
Rüben, grüner Klee. Es findet hier also statt: 1. Gartenwirtschaft,
2.
intensive freie Wirtschaft mit Dungankauf aus der Stadt. — Im
zweiten Kreise muß Forstwirtschaft zur Versorgung / der Stadt mit
Brenn- und Bauholz getrieben werden, und zwar näher der
Stadt Brennholz, entfernter Bauholz, dessen alte wertvolle Stämme
die Beförderung leichter bezahlen. — Im dritten Kreise findet Ge-
treidebau mit abnehmender Intensität statt, so daß sich hier drei
Unterabteilungen (Teilkreise) ergeben: Zunächst die intensivste,
das heißt den meisten Aufwand an Kapital und Arbeit erfordernde
Wirtschaft, die Fruchtwechselwirtschaft; dann die Koppel- oder Feld-
graswirtschaft; dann die extensivste oder Dreifelderwirtschaft
1
. —
Im vierten Hauptkreis wird Viehzucht, und zwar in der Form
getrieben, daß in den der Stadt näher gelegenen Gegenden Jungvieh
gezüchtet wird, das zur Mästung in die Zone des Getreidebaues ge-
schickt wird, während in den entfernteren Gegenden Transport-
tiere gezüchtet werden, also wertvollere Tiere, welche die Beför-
derungskosten wirtschaftlich leichter ertragen. — Im letzten Kreis
kann nur noch Jagd, deren wertvollere Nebenerzeugnisse, wie Felle,
Hörner und dergleichen, auf den Markt gebracht werden können,
betrieben werden.
b.
Übrige Theorien Thünens
Thünen ist zwar über Ricardos Wertlehre s y s t e m a t i s c h nicht
hinausgekommen, trotzdem er selbst nachwies, wie ungenügend sie ist;
jedoch hat er Erklärungen des Zinses und Lohnes gefunden, die den Bo-
den jener Wertlehre gänzlich verlassen und Gedanken der späteren
Grenznutzenlehre (ohne deren Fehler) vorwegnehmen
2
. Thünen hält so-
wohl beim Kapital wie bei der Arbeit die Verschiedenheit der Nutzungen
auseinander, welche die ersten und letzten Aufwände verursachen. „Die
Sorgfalt der Arbeit, z. B. beim Auflesen der Kartoffeln, darf nicht weiter
gehen, als bis die zuletzt aufgewendete Arbeit noch durch das Plus des
Ernteertrages vergütet wird.“
3
— Die H ö h e d e s Z i n s f u ß e s „wird
1
Zur Erklärung dieser Ackerbausysteme siehe unten S. 147.
2
Vgl. unten S. 199 ff.
3
Johann Heinrich von Thünen: Der isolierte Staat in Beziehung auf
Landwirtschaft und Nationalökonomie, 4. Aufl., Stuttgart 1966, S. 411.









