
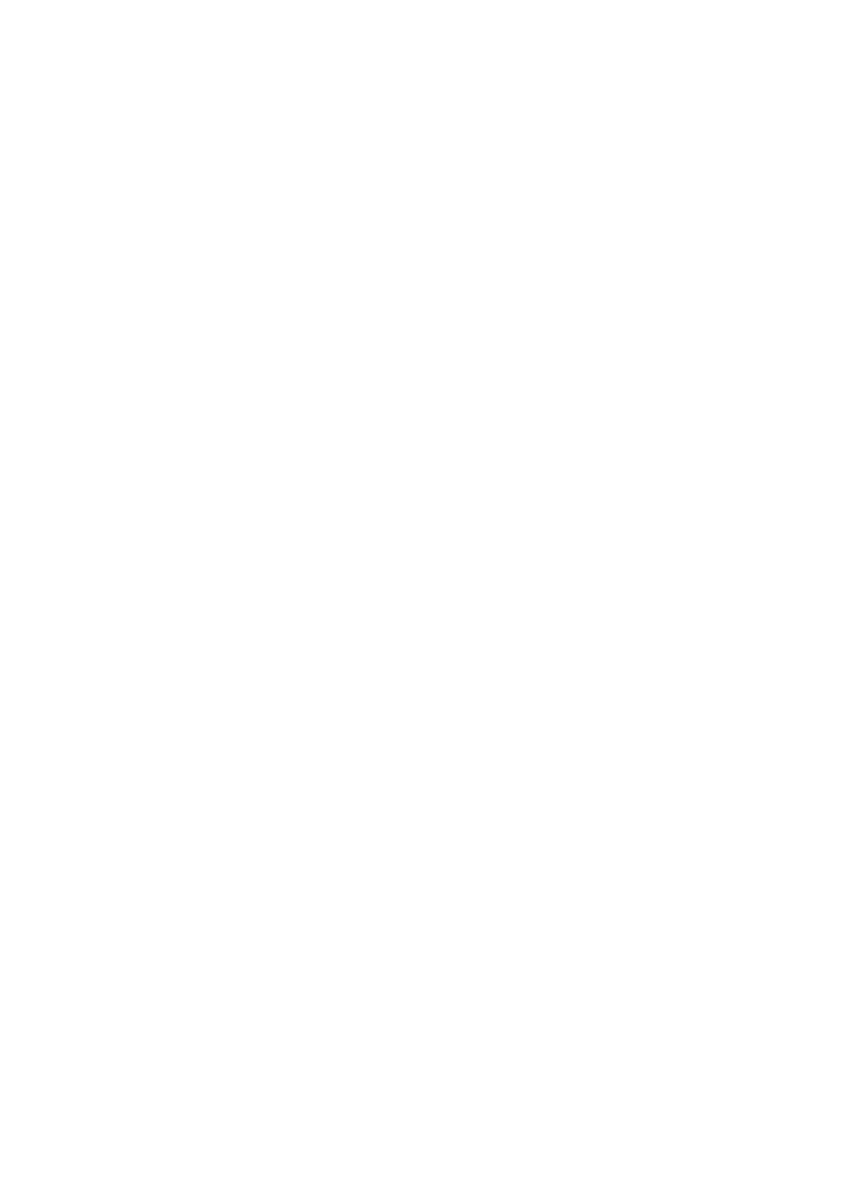
[55/56]
43
der sogenannte V o l u n t a r i s m u s , der die assoziierten Vorstel-
lungen durch den Willen zum Denken werden läßt.
Alle diese und ähnliche, mit ihnen verwandte Lehren, wie unter
anderem die oben berührte „Denkpsychologie", enthalten eine
grundsätzliche Trennung des Gedankens vom Sein des Gegenstan-
des, der Wirklichkeit. Wir können sie als A b b i l d t h e o r i e n
im weiteren Sinne zusammenfassen. „Abbild" dabei weniger im
Sinne einer zeichnerischen Nachbildung des Gegenstandes durch
Empfindung und Vorstellung (wie sie z. B. durch die camera obscura
der Netzhaut nahegelegt wird), sondern vielmehr in bloß sinnbild-
licher oder repräsentativer oder entsprechungsmäßiger Bedeutung.
Die Empfindung des Reizes gibt nicht den Naturvorgang (z. B. der
Ton nicht die Luftverdichtung der Wellen) wieder. Und was man
denkt, braucht nach dieser Auffassung erst recht kein Sein zu haben,
vielmehr kann es sich ähnlich wie bei dem Gedanken „Flügelpferd“
(das es ja gar nicht gibt) bei jedem Gedanken verhalten: Es sind
Kombinationen von Vorstellungen, die wohl aus Reizen stammen,
aber als Kombinationen keinen Objekten entsprechen müssen. Die
Abbildtheorie kann zur Mayalehre, nach der alles nur Schein ist,
werden!
Darum ist auch die grundsätzliche Ablehnung des ontologischen
Gottesbeweises, welcher bekanntlich vom Begriffe Gottes auf sein
Dasein schließt, stets / ein Zeugnis für eine solche Erkenntnislehre,
die zuletzt auf Abbildtheorie hinausläuft.
Ebenso bezeugen alle Philosophen, die eine f o r m a l e L o g i k
ausbilden, eine auf Abbildtheorie hinauslaufende Erkenntnislehre,
weil nur dann die F o r m e n des Denkens vom Inhalte getrennt
werden können.
Schon bei A r i s t o t e l e s findet sich der Vergleich der Seele mit
einer leeren Tafel, auf welche die Sinnesreize ihre Eindrücke schrei-
ben (aber bei Aristoteles steht dem die andere Lehre entgegen, daß
die Seele alle Formen in sich habe
1
. Die S t o a gebrauchte den
Vergleich von Siegelring und Wachsabdruck, wodurch die Wahrneh-
mung und Erkenntnis bezeichnet sein soll. Ähnlich die Scholastik,
namentlich die N o m i n a l i s t e n , welche den Vergleich mit der
leeren Tafel gebrauchten. Ebenso L o c k e , H u m e , der gesamte
1
1
Siehe oben S. 11.









