
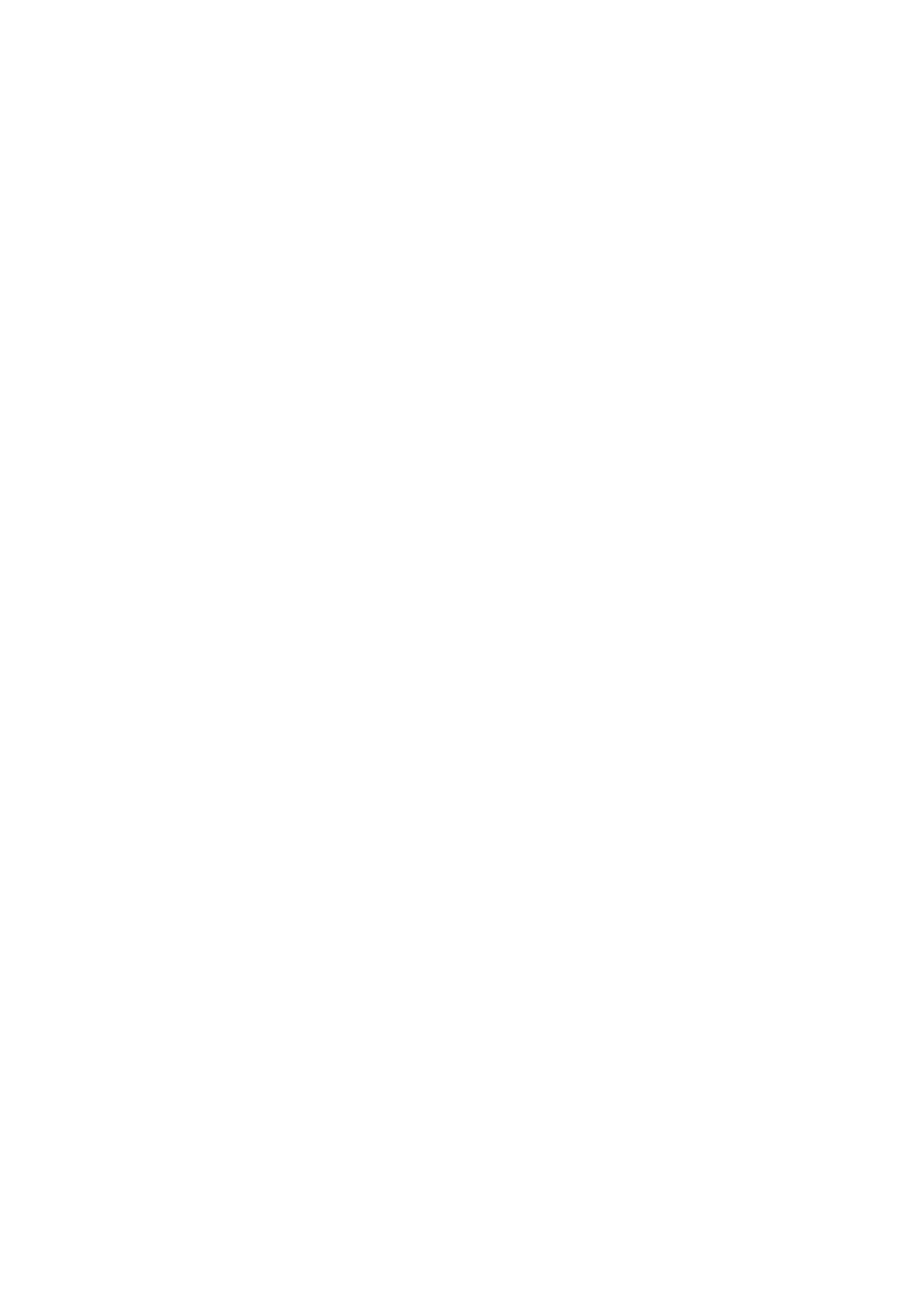
122
[170/171]
teil“
1
. Hegel verfällt aber in den Fehler, „Urteile des Seins" (entsprechend denen
der Qualität, nach der alten formalen Logik), ferner „des Wesens" (entsprechend
den Urteilen der Quantität), endlich „Urteile des Begriffs“ (entsprechend den
Urteilen der Relation und der Modalität) zu unterscheiden, und verwirrt und
verdunkelt dadurch seine eigene, einfache Urteilslehre (wie auch Kuno Fischer
bemerkt
1 2
). Schließlich wäre das aber eine mehr formale Frage. Schlimmer ist es,
daß Hegel in einem Atem den Begriff als das Einzelne bestimmt, so daß das
e i n z e l n e S u b j e k t d a s a l l g e m e i n e P r ä d i k a t wird — statt um-
gekehrt! Hegels Formel für das Urteil heißt: Das Allgemeine ist das Einzelne,
E = A! — Nach unserer Begriffsbestimmung muß das Gegenteil gesagt werden:
Der Begriff ist grundsätzlich — im Verhältnisse zum Prädikat — Gesamtgegen-
stand, also ein A l l g e m e i n e s gegenüber dem Teilgegenstande, dem Prädi-
kate!
Freilich gibt es auch den umgekehrten Fall, daß das Prädikat allgemeiner als
das Subjekt ist, dann nämlich, wenn das Denken nicht zerlegend, sondern ver-
allgemeinernd, das Urteil nicht ausgliedernd, sondern rückverbindend (in ein hö-
heres Allgemeines eingliedernd) ist, was aber erst später erklärt werden soll.
Diesen grundsätzlichen Irrtum Hegels, daß nämlich der Begriff das Einzelne,
das Prädikat das Allgemeine sei, teilte die gesamte Hegelschule mit dem Meister,
so daß von einem Loskommen von der formalen Logik in diesem Punkte, näm-
lich der Prädikationslehre, keine Rede sein konnte.
Eine große Wahrheit der Hegelischen Logik, welche dem heutigen empiristi-
schen Denken allerdings fremd erscheint, ist der Satz: „Alle Dinge sind ein
Urteil“ — ein Satz, der eine, wenn auch barock klingende, Folgerung aus der
Einerleiheit von Denken und Sein ist. Hegel waren aber auch alle Dinge ein
„Begriff“ und ebenso alle Dinge schließlich ein „Schluß“ (worauf wir noch zu-
rückkommen)!
Gegenüber der tiefen ontologischen Fundierung der Logik durch Hegel ist das
formalistische Gerede B o l z a n o s , z. B. / vom „Satz an sich“ (der nur aussagt,
daß etwas sei oder nicht sei) und der „Wahrheit an sich“, die vom Satze an sich
grundsätzlich getrennt sein soll (der „Satz an sich“ ist nur wahr, wenn er etwas
so, wie es ist, aussagt — vulgo, wenn er wahr ist!), ein entschiedener Rück-
schritt. — Andererseits tut man manchmal so, als ob Bolzano vor Hegel gewe-
sen sei.
Stimmen wir mit der durch Hegel zur Klarheit gebrachten, im allgemeinen
als i d e a l i s t i s c h zu bezeichnenden Urteilslehre überein, zu der wir auch
die p l a t o n i s c h e u n d a r i s t o t e l i s c h e Auffassung rechnen müssen, so
stehen wir, wie angedeutet, zur gesamten formalen, daher auch herbartischen,
und ferner zur empiristischen Urteilslehre in Widerspruch. Die Lehre vom Ur-
teile als einer „Verbindung“, „Verknüpfung“, „Beziehung“, „Relation“, „Syn-
these“ zweier Vorstellungen oder Begriffe, nämlich von Subjekt und Prädikat,
ist unvollziehbar. Woher soll es kommen, daß s i c h B e g r i f f e n a c h -
t r ä g l i c h „ v e r b i n d e n “ l a s s e n ? Sie sind doch nicht zufällig verbind-
bar, ihre Verbundenheit muß schon v o r h e r begründet, muß schon v o r -
g e g e b e n sein! Es ist die G l i e d h a f t i g k e i t , welche die bloß äußerliche
1
Kuno Fischer: System der Logik und Metaphysik, 3. Aufl., Heidelberg 1909,
S. 381.
2
Kuno Fischer: System . . ., Heidelberg 1909, S. 384 f.









