
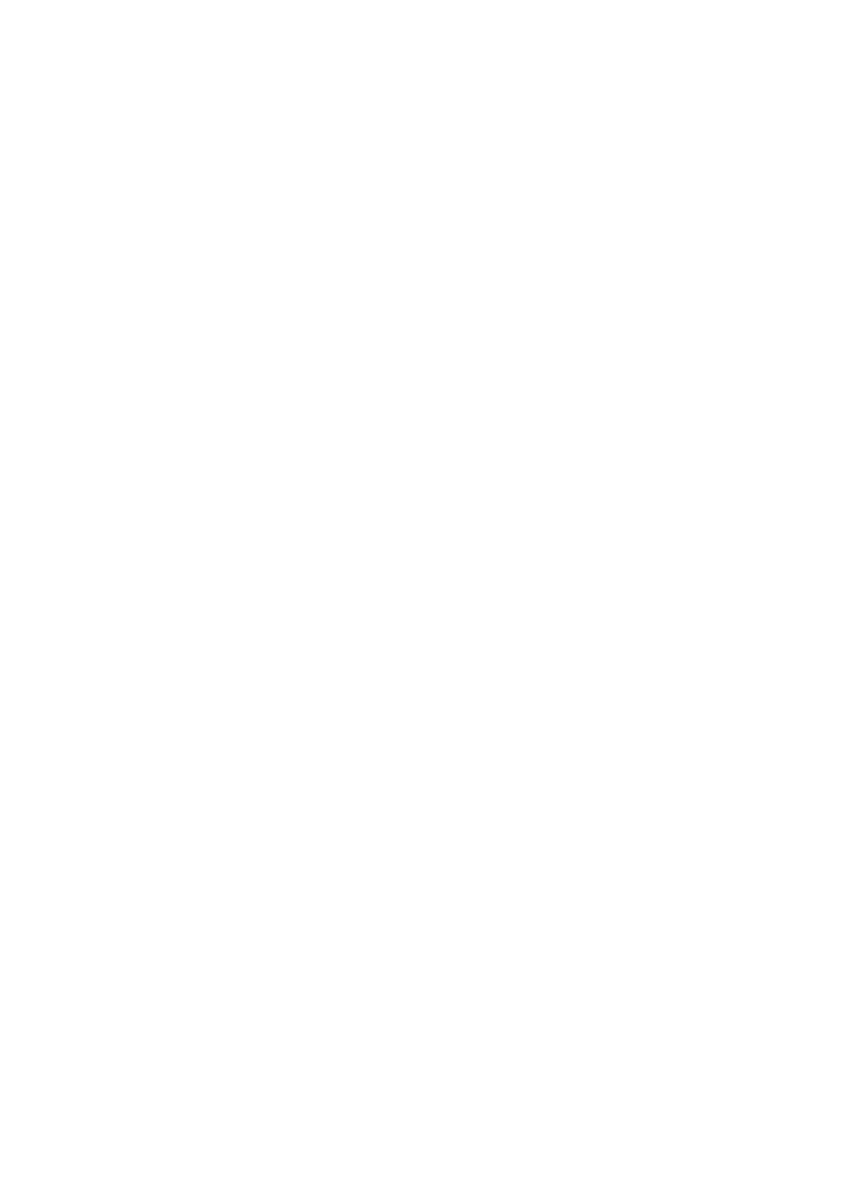
119
und dann würde eine urdualistische Auffassung vertreten. Diese
aber schließt den echten Begriff der Schöpfung aus, welcher auch die
Materie von Gott herleiten muß und Gott auch zum H e r r n der
Welt macht, nicht nur zum Weltbildner, „Demiurgen“, der mit
vorgegebenem Stoffe arbeitet.
Auf Platon und Aristoteles folgt der Neuplatonismus, gipfelnd
in P 1 o t i n. Plotin lehrt das absolute Eins (Hen), das schlechthin
einfach, vielheits- und bewegungslos ist. Durch E m a n a t i o n
schwächt es sich zum Urgeiste, Nus, ab, welcher schon vom Ur-
Einen ab- und ausgeschlossen ist. Auch dieser schwächt sich wieder
durch weitere Emanation ab usw. — An die Stelle des Schöpfungs-
begriffes und sogar des Begriffes des Weltbildners tritt also hier die
Emanation, das Ausfließen.
Gewiß läßt sich das auch so auffassen, daß das ,Emanieren' nur
ein Bild sei; jedoch ist damit bei Platon wenig für den Schöpfungs-
begriff zu retten. Denn ist ihm die Emanation auch nur ein Bild,
so sieht man doch nicht, wie die Abschwächung d u r c h Gott
zustandekomme. Zumal das Ur-Eine (Hen) in sich einfach, ununter-
scheidbar, ununterschieden, bewegungslos ist. Plotin, der ein großer
Mystiker war, hielt sich hier an das Erlebnis der schlechthinigen
Einheit in der ekstatischen Erfahrung. Diese ist Wahrheit, aber jene
begriffliche Ausdeutung, welche alle Mannigfaltigkeit und die
Materialität aus Abschwächung, gleichsam automatische Emanation
erklärt, vernichtet jeden Schöpfungsbegriff. Nicht einmal ein Welt-
bildner bleibt übrig. Dagegen ist der Urdualismus vermieden und
ein kosmogonischer M o n i s m u s gewonnen.
(Einzig der plotinische Begriff der R ü c k w e n d u n g oder
E p i s t r o p h e stellt eine gewisse Einheit der sonst voneinander
getrennten, emanierten Seinsebenen her, aber ein Ersatz für den
Schöpfungsbegriff ergibt sich daraus nicht.)
Allen diesen Lehrbegriffen steht der c h r i s t l i c h e S c h ö p -
f u n g s b e g r i f f gegenüber. Er findet im hl. A u g u s t i n u s
(354—430 n. Chr.) seinen vollständigsten Ausdruck. Gott findet
darnach nicht eine Materie vor. Überhaupt ist ihm kein Wesen ent-
gegengesetzt. Gott hat die Welt daher nicht aus etwas Vorgefun-
denem, sondern aus N i c h t s e r s c h a f f e n
1
. Das bedeutet
1
Augustinus: De civitate Dei XII, 2; XIV, 11.









