
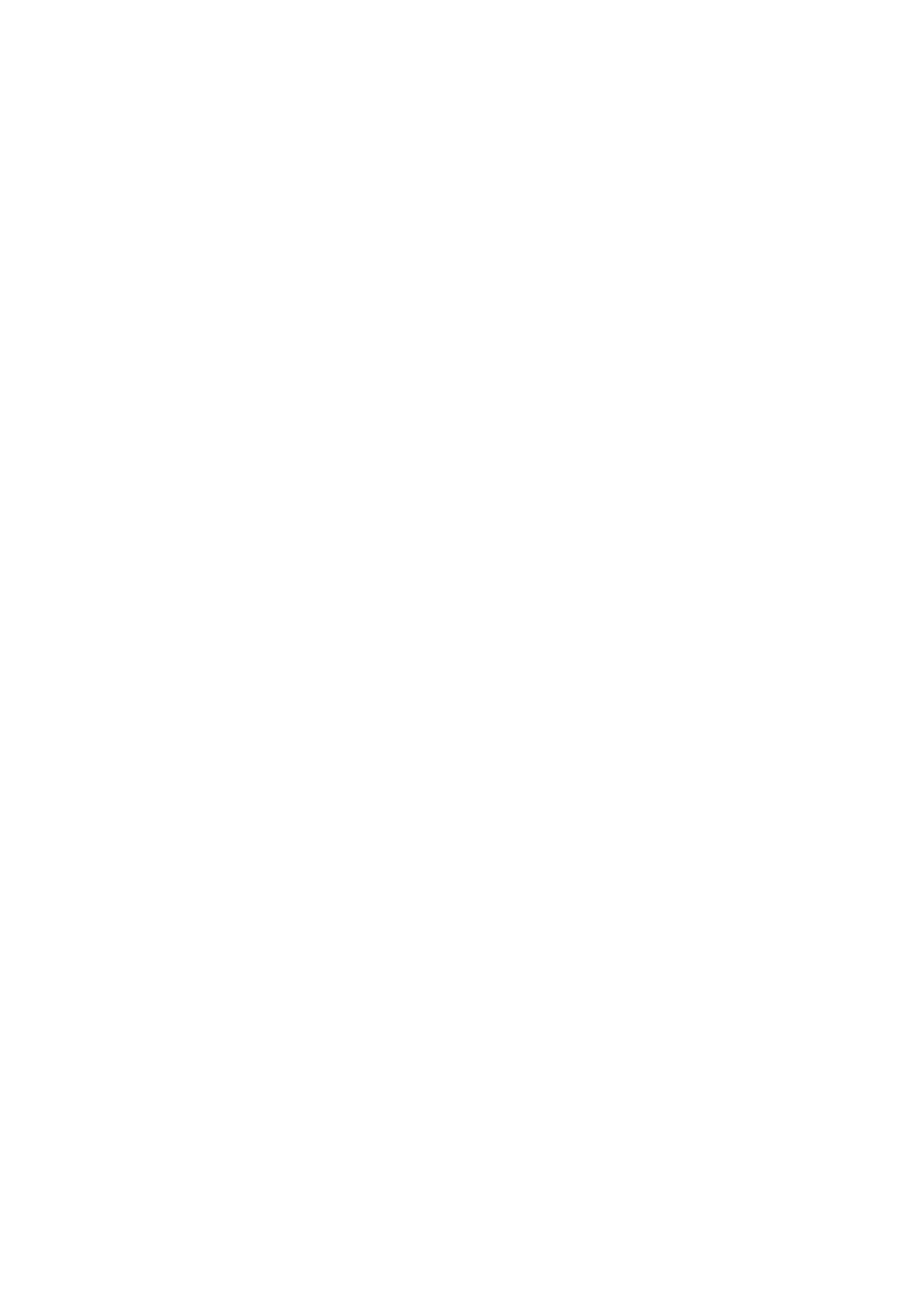
27
fertigung genug für das Wort der Bekräftigung geistiger Liebe gegen den Voll-
endeten, den Mann klassischen Lebens und klassischen Wirkens
1
.“
Gotthold Ephraim Lessing
(1729—1781) wirkt vor allem durch
seine Kritik, welche sich gegen das französische Drama im Stile
eines Corneille und Voltaire richtet und für Shakespeare eintritt.
Dabei wird die Winckelmannsche Ästhetik in der Richtung auf die
Poesie weiterentwickelt. Lessing tritt für die aristotelische Lehre
von der R e i n i g u n g
(κάϋ'αρσις)
durch die Tragödie ein und
vergleicht die aristotelische Poetik mit den Elementen des Euklid.
Lessing tritt für die dramatische Wahrheit, nicht die geschichtliche
Richtigkeit ein, das ist, für die innere, vom Charakter geforderte
Wahrheit. Dies hatte damals, sagt Schasler, „eine fast revolutionäre,
weil vom Konventionellen gänzlich abweichende Wirkung. Die
Alleinherrschaft des französischen Dramas ... wurde durch die Kri-
tik Lessings... bis auf den Grund erschüttert“
2
.
Die Ästhetik oder Kunstphilosophie selbst wurde dabei fast nur
mittelbar gefördert. Erst
Immanuel Kant
(1724—1804) bildete die
Ästhetik wirklich zum philosophischen Sonderfache aus. Erst er
vermochte dies aus dem Begriffszusammenhange seiner Philosophie
zu
leisten. Umwälzend wirkte seine in der „Kritik der Urteils-
kraft“ (1790) gegebene Begriffserklärung des Schönen:
Schön ist, was uninteressiert gefällt
3
, was ohne Begriff gefällt,
das heißt, nicht erst durch Begriffe erkennbar ist
4
, und was all-
gemein gefällt
5
.
Mit der klassisch gewordenen Bestimmung: schön ist, was uninter-
essiert gefällt, l ö s t e K a n t d a s S c h ö n e e n d g ü l t i g
1
Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling: Geschichte der neuen Philosophie,
Sämtliche Werke, Bd 4, Stuttgart 1856-1861.
2
Max Schasler: Kritische Geschichte der Ästhetik, ..., S. 466.
3
Immanuel Kant: Kritik der Urteilskraft: „Schön ist das, was in der bloßen
Beurteilung (nicht in der Sinnesempfindung, noch durch einen Begriff) gefällt.“
In: Kants Werke, Herausgegeben von der Königlich-preußischen Akademie der
Wissenschaften, Bd V, Berlin 1908, S. 204 f., 219 und 267.
4
Immanuel Kant: Kritik der Urteilskraft, ..., S. 211 f.
5
Immanuel Kant: Kritik der Urteilskraft, ..., S. 289: „Also ist es nicht die
Lust, sondern die Allgemeingültigkeit dieser Lust, die mit der bloßen Beurteilung
eines Gegenstandes im Gemüte als verbunden wahrgenommen wird, welche
a p r i o r i als allgemeine Regel für die Urteilskraft, für jedermann gültig, in
einem Geschmacksurteile vorgestellt wird. Es ist also ein Urteil apriori: daß ich
ihn (den Gegenstand) schön finde.“









